|
 Es
gibt sie immer noch - jene legendären Filme, die sich über
alle anderen emporheben und in das Gedächtnis der Menschen, vor
allem aber in ihre Seelen einschreiben. Die Handlungen dieser cineastischen
Meisterwerke sind oftmals grundverschieden, aber sie alle zeichnen sich
durch eine außergewöhnliche Bildhaftigkeit und beeindruckende
Tiefgängigkeit aus. Eine Gattung dieses Genres nennen Regisseure
wie Schauspieler oder Besucher "Gefühlsfilm" oder "Gefühlskino".
Dabei handelt es sich keineswegs um Herz-Schmerz-Opern oder tränenreiche
Schmonzetten mit Happyend. Erinnert sei hier an dramatische Filme wie
Es war eine rauschende Ballnacht, an Vom Winde verweht, an Doktor Schiwago,
an Die Dornenvögel, an Das Boot, an Der englische Patient, an Jenseits
von Afrika, an Das Piano oder an Uzala der Kirgise - nur um einige der
weltbesten Produktionen zu nennen. Mathilde - eine große Liebe,
entstanden aus dem Roman "Die französische Verlobte" von Sébastien
Japrisot, ist so ein Film. Regisseur Jean-Pierre Jeunet, der schon "Die
fabelhafte Welt der Amelie" drehte, führt auch in diesem Meisterwerk
Regie. In der Rolle der Mathilde brilliert Audrey Tatou, die bereits
als "Amelie" ihr herausragendes Können unter Beweis stellte. Es
gibt sie immer noch - jene legendären Filme, die sich über
alle anderen emporheben und in das Gedächtnis der Menschen, vor
allem aber in ihre Seelen einschreiben. Die Handlungen dieser cineastischen
Meisterwerke sind oftmals grundverschieden, aber sie alle zeichnen sich
durch eine außergewöhnliche Bildhaftigkeit und beeindruckende
Tiefgängigkeit aus. Eine Gattung dieses Genres nennen Regisseure
wie Schauspieler oder Besucher "Gefühlsfilm" oder "Gefühlskino".
Dabei handelt es sich keineswegs um Herz-Schmerz-Opern oder tränenreiche
Schmonzetten mit Happyend. Erinnert sei hier an dramatische Filme wie
Es war eine rauschende Ballnacht, an Vom Winde verweht, an Doktor Schiwago,
an Die Dornenvögel, an Das Boot, an Der englische Patient, an Jenseits
von Afrika, an Das Piano oder an Uzala der Kirgise - nur um einige der
weltbesten Produktionen zu nennen. Mathilde - eine große Liebe,
entstanden aus dem Roman "Die französische Verlobte" von Sébastien
Japrisot, ist so ein Film. Regisseur Jean-Pierre Jeunet, der schon "Die
fabelhafte Welt der Amelie" drehte, führt auch in diesem Meisterwerk
Regie. In der Rolle der Mathilde brilliert Audrey Tatou, die bereits
als "Amelie" ihr herausragendes Können unter Beweis stellte.
Geschichte
 Vor
dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges breitet Jean-Pierre Jeunet ein
opulentes bildgewaltiges Filmgemälde aus, im dem alle Facetten
menschlicher Leidenschaft und Leidensbereitschaft bis zur Neige ausgeschöpft
werden. Da sind fünf verwundete französische Soldaten, die
von den eigenen Befehlshabern in den sicheren Tod geschickt werden -
um sich zu bewähren, wie es die Herren im Generalstab geschmeidig
formulieren. Da ist eine junge gehbehinderte Frau (die Romanfigur leidet
an Kinderlähmung und sitzt im Rollstuhl), die trotz aller Schreckensnachrichten,
die ihr heimkehrende Kriegskrüppel und Soldaten vom Leben und Sterben
an der Front erzählen, unerschütterlich an die Rückkehr
ihres geliebten Manech glaubt, auch wenn darüber Jahr um Jahr vergeht.
Die zarten Pastellfarben tauchen die unbekümmerte Lebenserwartung
der Mathilde in ein sakrales Licht, welches im nächsten Augenblick
die Fratze des Krieges und das Antlitz des Todes umhüllt. Jeunet
jongliert in diesem Film meisterlich mit visuellen Eindrücken und
dem Sekundenwechsel zwischen Frieden - Krieg - Sterben und Tod. Vor
dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges breitet Jean-Pierre Jeunet ein
opulentes bildgewaltiges Filmgemälde aus, im dem alle Facetten
menschlicher Leidenschaft und Leidensbereitschaft bis zur Neige ausgeschöpft
werden. Da sind fünf verwundete französische Soldaten, die
von den eigenen Befehlshabern in den sicheren Tod geschickt werden -
um sich zu bewähren, wie es die Herren im Generalstab geschmeidig
formulieren. Da ist eine junge gehbehinderte Frau (die Romanfigur leidet
an Kinderlähmung und sitzt im Rollstuhl), die trotz aller Schreckensnachrichten,
die ihr heimkehrende Kriegskrüppel und Soldaten vom Leben und Sterben
an der Front erzählen, unerschütterlich an die Rückkehr
ihres geliebten Manech glaubt, auch wenn darüber Jahr um Jahr vergeht.
Die zarten Pastellfarben tauchen die unbekümmerte Lebenserwartung
der Mathilde in ein sakrales Licht, welches im nächsten Augenblick
die Fratze des Krieges und das Antlitz des Todes umhüllt. Jeunet
jongliert in diesem Film meisterlich mit visuellen Eindrücken und
dem Sekundenwechsel zwischen Frieden - Krieg - Sterben und Tod.  Der
Krieg als Schreckgespenst ist kein wirklich greifbares Individuum mehr,
sondern ein technisiertes, mechanisches Untier, durch das der Tod, das
elende Krepieren anonymisiert, gesichtslos wird. Es ist der erste Krieg
der Menschheit, wo sich Soldaten über große Entfernungen
gegenseitig in den Tod schicken, ohne sich jemals persönlich zu
begegnen. Technische Monster erledigen das, was früher als Kampf
Mann gegen Mann bezeichnet wurde. Das Aufeinanderprallen großer
Heeresverbände wurde durch die massive Anhäufung riesiger
Kriegsmaterialmengen ersetzt, die zu Wasser, zu Lande und in der Luft
den Tod und die Vernichtung in das jeweils andere Lager trugen. Historiker
nannten später diesen großen Krieg den Ersten Weltkrieg,
weil er Menschen aus allen Kontinenten in diesen Kampf einbezog. Ihm
sollte nur zwanzig Jahre später ein weiterer Krieg folgen, der
in die Annalen als der Zweite Weltkrieg einging. In ihm wurde die Präzision
und Massierung der gesichtslosen und anonymen Tötung großer
Menschenmassen zur Perfektion geführt. Der
Krieg als Schreckgespenst ist kein wirklich greifbares Individuum mehr,
sondern ein technisiertes, mechanisches Untier, durch das der Tod, das
elende Krepieren anonymisiert, gesichtslos wird. Es ist der erste Krieg
der Menschheit, wo sich Soldaten über große Entfernungen
gegenseitig in den Tod schicken, ohne sich jemals persönlich zu
begegnen. Technische Monster erledigen das, was früher als Kampf
Mann gegen Mann bezeichnet wurde. Das Aufeinanderprallen großer
Heeresverbände wurde durch die massive Anhäufung riesiger
Kriegsmaterialmengen ersetzt, die zu Wasser, zu Lande und in der Luft
den Tod und die Vernichtung in das jeweils andere Lager trugen. Historiker
nannten später diesen großen Krieg den Ersten Weltkrieg,
weil er Menschen aus allen Kontinenten in diesen Kampf einbezog. Ihm
sollte nur zwanzig Jahre später ein weiterer Krieg folgen, der
in die Annalen als der Zweite Weltkrieg einging. In ihm wurde die Präzision
und Massierung der gesichtslosen und anonymen Tötung großer
Menschenmassen zur Perfektion geführt.
Doch zurück zu Jean-Pierre Jeunet´s Meisterwerk von Mathilde und ihrer großen Liebe.
 Die
junge Frau ist weit davon entfernt zu glauben, dass ihr geliebter Manech
zwischen den Fronten verblutete, selbst als sie die Nachricht von seinem
Tod erhält, weigert sie sich an das Unfassbare zu glauben. Hier
offenbart sich in beeindruckender Offenheit das Wechselspiel in den
Gefühlen Mathildes; auf der einen Seite ihre unbeugsame Hartnäckigkeit,
die sie unbeirrt an den lebenden Manech glauben lässt und auf der
anderen Seite die furchtbare Realität des geschichtlichen Umfeldes,
das keinen Raum lässt für Hoffnung an ein Weiterleben. Und
da sind die Soldaten, junge Burschen, fast noch Kinder. Die
junge Frau ist weit davon entfernt zu glauben, dass ihr geliebter Manech
zwischen den Fronten verblutete, selbst als sie die Nachricht von seinem
Tod erhält, weigert sie sich an das Unfassbare zu glauben. Hier
offenbart sich in beeindruckender Offenheit das Wechselspiel in den
Gefühlen Mathildes; auf der einen Seite ihre unbeugsame Hartnäckigkeit,
die sie unbeirrt an den lebenden Manech glauben lässt und auf der
anderen Seite die furchtbare Realität des geschichtlichen Umfeldes,
das keinen Raum lässt für Hoffnung an ein Weiterleben. Und
da sind die Soldaten, junge Burschen, fast noch Kinder.  Frisch
weg von der Schulbank wie überall dort, wo der Krieg sogar die
Ungeborenen verschlingt. Jubelnd und Jauchzend, begleitet vom Getöse
der Marschkapellen zogen sie hinaus das Vaterland zu verteidigen, um
bis Weihnachten wieder zu Hause zu sein. So begann es auf allen Seiten.
Doch der Krieg kennt weder Weihnachten noch Ostern. Er kennt auch keine
Sonntage oder Ferien. Der Krieg ist unersättlich und schreit unentwegt
nach frischem Fleisch. Nach vier Jahren des Ausblutens, des Sterbens
und Leidens existiert die Euphorie der ersten Tage nur noch als geschichtliche
Metapher. Die fünf jungen Soldaten wissen, dass der Tod auf sie
wartet - und sie haben Angst, ganz erbärmliche Todesangst. Angst
vor dem Gas, den Granaten, dem Dreck und Schlamm in den Schützengräben,
Angst vor Verstümmelung, vor schwerer Verwundung und Angst vor
einem grässlichen Bauchschuss. Frisch
weg von der Schulbank wie überall dort, wo der Krieg sogar die
Ungeborenen verschlingt. Jubelnd und Jauchzend, begleitet vom Getöse
der Marschkapellen zogen sie hinaus das Vaterland zu verteidigen, um
bis Weihnachten wieder zu Hause zu sein. So begann es auf allen Seiten.
Doch der Krieg kennt weder Weihnachten noch Ostern. Er kennt auch keine
Sonntage oder Ferien. Der Krieg ist unersättlich und schreit unentwegt
nach frischem Fleisch. Nach vier Jahren des Ausblutens, des Sterbens
und Leidens existiert die Euphorie der ersten Tage nur noch als geschichtliche
Metapher. Die fünf jungen Soldaten wissen, dass der Tod auf sie
wartet - und sie haben Angst, ganz erbärmliche Todesangst. Angst
vor dem Gas, den Granaten, dem Dreck und Schlamm in den Schützengräben,
Angst vor Verstümmelung, vor schwerer Verwundung und Angst vor
einem grässlichen Bauchschuss.
Regisseur Jeunet
gelang der Spagat zwischen der realistischen Darstellung des Vegetierens
in den Schützengräben und der Bereitschaft der Schauspieler
zur Leidensfähigkeit, um den "Film-Soldaten" ein Höchstmaß
an Authentizität zu verleihen. Es ist letztlich nicht damit getan
einen Graben auszuheben, Schauspieler und Statisten hineinzustellen,
um das Ganze dann mit viel Getöse auf den Film zu bannen. 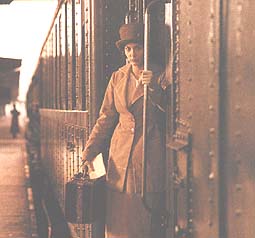 Seit
dem Film "Im Westen nichts Neues", der wegweisende Maßstäbe
setzte, hat das Genre "Anti-Kriegsfilm" unzählige Streifen hervorgebracht.
Aber nur wenige sind in die Geschichte des Kinofilms als wirklich große
Schöpfungen eingegangen. Der Perfektionist Jeunet überließ
am Set nichts dem Zufall. Schon Monate zuvor studierten er und sein
Team authentische Berichte, Militärkarten, Bücher und Fotos,
lasen Briefe der Soldaten und Chroniken zum großen Sterben an
der Westfront. Alles und jegliches sollte so realistisch wie möglich
dargestellt werden. Die Bereitstellung des Materials erforderte demnach
ein Höchstmaß an Präzision und Organisation. Uniformen,
Waffen, Fahrzeuge, der gesamte Tross, der in einem Krieg notwendig ist,
musste beschafft oder angefertigt werden. Und das alles originalgetreu.
Doch die kriegerischen Abläufe stellen nur einen Teil der Handlung
dar. Die Seite des Friedens um Mathilde musste ebenfalls dem Stil der
Zeit gemäß aufbereitet und dargestellt werden. Beides zusammen
stellte das Team um Jean-Pierre Jeunet vor eine große Aufgabe,
die sie mit Erfolg gemeistert haben. Seit
dem Film "Im Westen nichts Neues", der wegweisende Maßstäbe
setzte, hat das Genre "Anti-Kriegsfilm" unzählige Streifen hervorgebracht.
Aber nur wenige sind in die Geschichte des Kinofilms als wirklich große
Schöpfungen eingegangen. Der Perfektionist Jeunet überließ
am Set nichts dem Zufall. Schon Monate zuvor studierten er und sein
Team authentische Berichte, Militärkarten, Bücher und Fotos,
lasen Briefe der Soldaten und Chroniken zum großen Sterben an
der Westfront. Alles und jegliches sollte so realistisch wie möglich
dargestellt werden. Die Bereitstellung des Materials erforderte demnach
ein Höchstmaß an Präzision und Organisation. Uniformen,
Waffen, Fahrzeuge, der gesamte Tross, der in einem Krieg notwendig ist,
musste beschafft oder angefertigt werden. Und das alles originalgetreu.
Doch die kriegerischen Abläufe stellen nur einen Teil der Handlung
dar. Die Seite des Friedens um Mathilde musste ebenfalls dem Stil der
Zeit gemäß aufbereitet und dargestellt werden. Beides zusammen
stellte das Team um Jean-Pierre Jeunet vor eine große Aufgabe,
die sie mit Erfolg gemeistert haben.
Drehorte
Filme, die in ihrer Handlung eine andere Zeit präsentieren als die Gegenwart, müssen vor allem durch glaubwürdige Kulissen überzeugen. So auch beim Film Mathilde - eine große Liebe. Hier ging es um die Darstellung der Schützengräben und Frontlinie - eine Herausforderung der ganz besonderen Art. Jeunet sagte selbst, dass das Team beim Nachbau der Kampfgräben und Unterstände an seine Grenzen ging, und die Probleme sehr groß waren. Die ehemaligen Kriegsschauplätze konnten oder durften wir nicht nutzen. Landwirtschaftliche Nutzflächen hätten wir zu sehr in Mitleidenschaft gezogen, und kein Studiogelände erfüllte die an diesen speziellen Teil des Films gestellten Ansprüche. Schließlich entschied man sich für einen Truppenübungsplatz in der Nähe von Poitiers. Echt und Originalgetreu musste alles wirken aber dennoch sicher für die Schauspieler und das Team am Set. Wochenlanger Dauerregen durfte die Anlage nicht zum Einsturz bringen, Schlamm und Wasser die Dreharbeiten nicht gefährden. Um vor Beginn der Dreharbeiten alle Gefahrenpunkte zu erkennen, bauten die Techniker um Jean-Pierre Jeunet ein sieben Meter langes Modell der Anlage. Danach begann der wirkliche Ausbau des Grabensystems, der mehr als sechs Wochen in Anspruch nahm. Ein Gelände von mehr als 20 Hektar wurde für die Nutzung der Dreharbeiten beansprucht. Das Team schuf auf dem Truppenübungsplatz im wahrsten Sinne des Wortes einen "lebendigen Ausschnitt" der Westfront des Jahres 1917. Jeder Zentimeter der Kampfzone wurde "Originalgetreu" nachgebildet - eine Herkulesarbeit. Nach Abschluss der Dreharbeiten versetzten die Mitarbeiter das Gelände wieder in seinen Urzustand zurück.
Die Zusammenarbeit
mit der Kostümbildnerin Madeline Fontaine war hervorragend, denn
für die wechselnden Drehorte und Zeitpunkte wurden Unmengen an
Kostümen und Staffagen benötigt - alles nach originalen Vorbildern
angefertigt. Zeitweilig mussten mehr als 400 verschiedene Ausstattungen
- zum Teil Original aus Frankreich, Spanien und England - für die
Filmaufnahmen bereitgestellt werden, etwa bei den Szenen auf der Place
de l'Opera in Paris.  Für
die 200 Uniformen der Soldaten benötigte man zweieinhalb Kilometer
himmelblauen Stoff, der eigens dafür gewebt wurde. Der Zeitraum
der Dreharbeiten erstreckte sich vom August 2003 bis zum Februar 2004.
Zu Beginn hielt sich das Team auf Korsika auf, wechselte aber dann nach
Paris und seine Umgebung über, wo die Arbeit erst richtig begann.
Auch in der Bretagne drehte Jeunet mit seiner Crew, bevor es dann in
die Schützengräben von Poitiers ging. Zum Abschluss des Films
wurden noch Szenen in den Bry-sur-Marne- Studios gedreht. Auch in diesem
Film wird die unverkennbare Handschrift Jeunets sichtbar - sein Hang
zur pedantisch genauen und detaillierten Vorbereitung der Aufnahmen.
Vor Beginn der "echten" Filmaufnahmen sondierte Jeunet mit seiner Handkamera
das Set um festzustellen, ob die Bildausschnitte und Kameraführungen
tatsächlich so funktionieren, wie es im Drehbuch von ihm vorgesehen
war. Für
die 200 Uniformen der Soldaten benötigte man zweieinhalb Kilometer
himmelblauen Stoff, der eigens dafür gewebt wurde. Der Zeitraum
der Dreharbeiten erstreckte sich vom August 2003 bis zum Februar 2004.
Zu Beginn hielt sich das Team auf Korsika auf, wechselte aber dann nach
Paris und seine Umgebung über, wo die Arbeit erst richtig begann.
Auch in der Bretagne drehte Jeunet mit seiner Crew, bevor es dann in
die Schützengräben von Poitiers ging. Zum Abschluss des Films
wurden noch Szenen in den Bry-sur-Marne- Studios gedreht. Auch in diesem
Film wird die unverkennbare Handschrift Jeunets sichtbar - sein Hang
zur pedantisch genauen und detaillierten Vorbereitung der Aufnahmen.
Vor Beginn der "echten" Filmaufnahmen sondierte Jeunet mit seiner Handkamera
das Set um festzustellen, ob die Bildausschnitte und Kameraführungen
tatsächlich so funktionieren, wie es im Drehbuch von ihm vorgesehen
war.
Mit großer Intensität ging es dann in die Szenen hinein, die von allen Beteiligten ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen verlangten. Besonders die Aufnahmen in den Schützengräben und Granattrichtern ließen keinen der Beteiligten unberührt. Aber auch das Leben in der Etappe mit seiner dumpfen Plackerei und dem monotonen Leerlauf stellen einen wichtigen Bestandteil des Films dar.
Manech - Mathildes Verlobter - träumt im Dreck der Gräben von seiner Rückkehr an die Seite seiner Verlobten und der baldigen Hochzeit. Wenn diese Sache beendet ist, darf ich endlich nach Hause..."
Der Traum eines jeden Soldaten, einfach die Waffen wegzuwerfen und nach Hause zu gehen. Doch an einem Morgen an der Front findet eine Granate wie von Geisterhand beschworen den Weg zu Manech und seinen Freunden...
Doch nicht nur
Kampfszenen stellten eine Herausforderung an das Team, sondern auch
"ganz normale" Begebenheiten, so den Straßenverkehr auf der Place
de l'Opera zu jener Zeit.  Zunächst
wurde der verkehrsleere Platz gefilmt, dann auf dem Außengelände
eines Automobil-Testcenters mit allen Oldtimer Gefährten der damaligen
Zeit gedreht. Zum Schluss drehte man noch eine Szene im Büro des
Detektivs Germain Pire ab. Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen
an Jeunet und sein Team wurde niemals die emotionale Seite der Handlung
und Romanvorlage außer acht gelassen, wenngleich der Film sich
im Ablauf ausschließlich an der Realität orientiert. Da bilden
natürliche Geräusche wie die Meeresbrandung an der bretonischen
Küste und der abstrakte Kampflärm an der Front bildbeeinflussende
Gestaltungsmittel von elementarer Wucht. Beinahe zart und verloren dagegen
die Bemühungen Mathildes der Tuba einige Töne zu entlocken,
die hinaushallen in die Welt der Schützengräben und Granattrichter
und immer wieder den Namen ihres Verlobten rufen - Manech - wo bist
du? Manech - ich warte auf dich. Sieben lange Jahre sucht, hofft und
wartet Mathilde auf die Rückkehr ihres Verlobten Manech - vergebens. Zunächst
wurde der verkehrsleere Platz gefilmt, dann auf dem Außengelände
eines Automobil-Testcenters mit allen Oldtimer Gefährten der damaligen
Zeit gedreht. Zum Schluss drehte man noch eine Szene im Büro des
Detektivs Germain Pire ab. Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen
an Jeunet und sein Team wurde niemals die emotionale Seite der Handlung
und Romanvorlage außer acht gelassen, wenngleich der Film sich
im Ablauf ausschließlich an der Realität orientiert. Da bilden
natürliche Geräusche wie die Meeresbrandung an der bretonischen
Küste und der abstrakte Kampflärm an der Front bildbeeinflussende
Gestaltungsmittel von elementarer Wucht. Beinahe zart und verloren dagegen
die Bemühungen Mathildes der Tuba einige Töne zu entlocken,
die hinaushallen in die Welt der Schützengräben und Granattrichter
und immer wieder den Namen ihres Verlobten rufen - Manech - wo bist
du? Manech - ich warte auf dich. Sieben lange Jahre sucht, hofft und
wartet Mathilde auf die Rückkehr ihres Verlobten Manech - vergebens.
Regisseur
Jean-Pierre Jeunet zählt zu den ganz Großen im Filmgeschäft. Mit "Die fabelhafte Welt der Amelie" machte er weltweit Furore. Aber auch Genre Science Fiction und Makabres wusste Jeunet zu überzeugen. Alien - die Wiedergeburt und Delikatessen gehören zu den herausragenden Werken dieses Regisseurs.
Schauspieler
Audrey Tautou überzeugte bereits als verträumte Kellnerin in "Die fabelhafte Welt der Amelie". Mit "Mathilde - eine große Liebe" hat sie sich selbst ein filmisches Denkmal gesetzt. Darüber hinaus spielte sie in Happy End, Wahnsinnig verliebt, Barcelona für ein Jahr und Die Liebeslust und die Freiheit herausragend.
Gaspard Ulliel und sein Hang zum Mysteriösen, Unwägbaren ließen ihn in Filmen wie "Der Pakt der Wölfe" und Belphegor - das Phantom des Louvre" brillieren. Aber auch "Paris - je t'aime", "Küss mich wenn du willst" und "Lehrjahre in Paris" machten ihn über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt. In Mathilde - eine große Liebe, ist er die ideale Besetzung des Manech an der Seite von Audrey Tautou.
Julie Depardieu, Tochter des berühmten Gerard Depardieu spielt in Mathilde die Véronique Passavant. In 2004 konnte sie als beste Nachwuchsschauspielerin mit dem Film Little Lilli den französischen "César" gewinnen.
Dominique Pinion, ein Gesicht, dass man nicht vergisst. Wer erinnert sich nicht an seine Rolle in "Die Stadt der verlorenen Kinder", an "Delikatessen", an "Alien - die Wiedergeburt" oder an seine phantastische Leistung im TV-Mehrteiler "Via Mala". Hier spielt er den Sylvain so überzeugend wie kein anderer.
Kostüme
Madeline Fontaine sorgte bereits in "Die fabelhafte Welt der Amelie" für das richtige "Dressing" der Akteure. Sie machte ihren Job so gut, dass Jeunet sie gleich für Mathilde - eine große Liebe verpflichtete.
Musik
Mit Angelo Badalamenti gewann Jeunet einen hervorragenden Kompositeur, der bereits mit Preisen überhäuft wurde, unter anderem für die Musik zu "Twin Peaks". Weitere Werke sind "Mulholland Drive", "Eine wahre Geschichte", "Stadt der verlorenen Kinder" und Nightmare".
Im Verleih der Warner Bros. Pictures Deutschland
Internet: www.mathilde-derfilm.de |
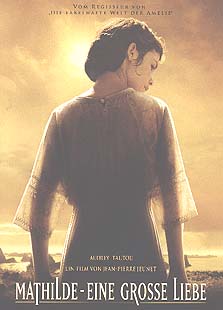


 Der
Krieg als Schreckgespenst ist kein wirklich greifbares Individuum mehr,
sondern ein technisiertes, mechanisches Untier, durch das der Tod, das
elende Krepieren anonymisiert, gesichtslos wird. Es ist der erste Krieg
der Menschheit, wo sich Soldaten über große Entfernungen
gegenseitig in den Tod schicken, ohne sich jemals persönlich zu
begegnen. Technische Monster erledigen das, was früher als Kampf
Mann gegen Mann bezeichnet wurde. Das Aufeinanderprallen großer
Heeresverbände wurde durch die massive Anhäufung riesiger
Kriegsmaterialmengen ersetzt, die zu Wasser, zu Lande und in der Luft
den Tod und die Vernichtung in das jeweils andere Lager trugen. Historiker
nannten später diesen großen Krieg den Ersten Weltkrieg,
weil er Menschen aus allen Kontinenten in diesen Kampf einbezog. Ihm
sollte nur zwanzig Jahre später ein weiterer Krieg folgen, der
in die Annalen als der Zweite Weltkrieg einging. In ihm wurde die Präzision
und Massierung der gesichtslosen und anonymen Tötung großer
Menschenmassen zur Perfektion geführt.
Der
Krieg als Schreckgespenst ist kein wirklich greifbares Individuum mehr,
sondern ein technisiertes, mechanisches Untier, durch das der Tod, das
elende Krepieren anonymisiert, gesichtslos wird. Es ist der erste Krieg
der Menschheit, wo sich Soldaten über große Entfernungen
gegenseitig in den Tod schicken, ohne sich jemals persönlich zu
begegnen. Technische Monster erledigen das, was früher als Kampf
Mann gegen Mann bezeichnet wurde. Das Aufeinanderprallen großer
Heeresverbände wurde durch die massive Anhäufung riesiger
Kriegsmaterialmengen ersetzt, die zu Wasser, zu Lande und in der Luft
den Tod und die Vernichtung in das jeweils andere Lager trugen. Historiker
nannten später diesen großen Krieg den Ersten Weltkrieg,
weil er Menschen aus allen Kontinenten in diesen Kampf einbezog. Ihm
sollte nur zwanzig Jahre später ein weiterer Krieg folgen, der
in die Annalen als der Zweite Weltkrieg einging. In ihm wurde die Präzision
und Massierung der gesichtslosen und anonymen Tötung großer
Menschenmassen zur Perfektion geführt.
 Frisch
weg von der Schulbank wie überall dort, wo der Krieg sogar die
Ungeborenen verschlingt. Jubelnd und Jauchzend, begleitet vom Getöse
der Marschkapellen zogen sie hinaus das Vaterland zu verteidigen, um
bis Weihnachten wieder zu Hause zu sein. So begann es auf allen Seiten.
Doch der Krieg kennt weder Weihnachten noch Ostern. Er kennt auch keine
Sonntage oder Ferien. Der Krieg ist unersättlich und schreit unentwegt
nach frischem Fleisch. Nach vier Jahren des Ausblutens, des Sterbens
und Leidens existiert die Euphorie der ersten Tage nur noch als geschichtliche
Metapher. Die fünf jungen Soldaten wissen, dass der Tod auf sie
wartet - und sie haben Angst, ganz erbärmliche Todesangst. Angst
vor dem Gas, den Granaten, dem Dreck und Schlamm in den Schützengräben,
Angst vor Verstümmelung, vor schwerer Verwundung und Angst vor
einem grässlichen Bauchschuss.
Frisch
weg von der Schulbank wie überall dort, wo der Krieg sogar die
Ungeborenen verschlingt. Jubelnd und Jauchzend, begleitet vom Getöse
der Marschkapellen zogen sie hinaus das Vaterland zu verteidigen, um
bis Weihnachten wieder zu Hause zu sein. So begann es auf allen Seiten.
Doch der Krieg kennt weder Weihnachten noch Ostern. Er kennt auch keine
Sonntage oder Ferien. Der Krieg ist unersättlich und schreit unentwegt
nach frischem Fleisch. Nach vier Jahren des Ausblutens, des Sterbens
und Leidens existiert die Euphorie der ersten Tage nur noch als geschichtliche
Metapher. Die fünf jungen Soldaten wissen, dass der Tod auf sie
wartet - und sie haben Angst, ganz erbärmliche Todesangst. Angst
vor dem Gas, den Granaten, dem Dreck und Schlamm in den Schützengräben,
Angst vor Verstümmelung, vor schwerer Verwundung und Angst vor
einem grässlichen Bauchschuss.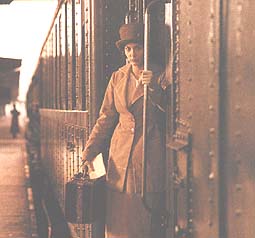 Seit
dem Film "Im Westen nichts Neues", der wegweisende Maßstäbe
setzte, hat das Genre "Anti-Kriegsfilm" unzählige Streifen hervorgebracht.
Aber nur wenige sind in die Geschichte des Kinofilms als wirklich große
Schöpfungen eingegangen. Der Perfektionist Jeunet überließ
am Set nichts dem Zufall. Schon Monate zuvor studierten er und sein
Team authentische Berichte, Militärkarten, Bücher und Fotos,
lasen Briefe der Soldaten und Chroniken zum großen Sterben an
der Westfront. Alles und jegliches sollte so realistisch wie möglich
dargestellt werden. Die Bereitstellung des Materials erforderte demnach
ein Höchstmaß an Präzision und Organisation. Uniformen,
Waffen, Fahrzeuge, der gesamte Tross, der in einem Krieg notwendig ist,
musste beschafft oder angefertigt werden. Und das alles originalgetreu.
Doch die kriegerischen Abläufe stellen nur einen Teil der Handlung
dar. Die Seite des Friedens um Mathilde musste ebenfalls dem Stil der
Zeit gemäß aufbereitet und dargestellt werden. Beides zusammen
stellte das Team um Jean-Pierre Jeunet vor eine große Aufgabe,
die sie mit Erfolg gemeistert haben.
Seit
dem Film "Im Westen nichts Neues", der wegweisende Maßstäbe
setzte, hat das Genre "Anti-Kriegsfilm" unzählige Streifen hervorgebracht.
Aber nur wenige sind in die Geschichte des Kinofilms als wirklich große
Schöpfungen eingegangen. Der Perfektionist Jeunet überließ
am Set nichts dem Zufall. Schon Monate zuvor studierten er und sein
Team authentische Berichte, Militärkarten, Bücher und Fotos,
lasen Briefe der Soldaten und Chroniken zum großen Sterben an
der Westfront. Alles und jegliches sollte so realistisch wie möglich
dargestellt werden. Die Bereitstellung des Materials erforderte demnach
ein Höchstmaß an Präzision und Organisation. Uniformen,
Waffen, Fahrzeuge, der gesamte Tross, der in einem Krieg notwendig ist,
musste beschafft oder angefertigt werden. Und das alles originalgetreu.
Doch die kriegerischen Abläufe stellen nur einen Teil der Handlung
dar. Die Seite des Friedens um Mathilde musste ebenfalls dem Stil der
Zeit gemäß aufbereitet und dargestellt werden. Beides zusammen
stellte das Team um Jean-Pierre Jeunet vor eine große Aufgabe,
die sie mit Erfolg gemeistert haben. Für
die 200 Uniformen der Soldaten benötigte man zweieinhalb Kilometer
himmelblauen Stoff, der eigens dafür gewebt wurde. Der Zeitraum
der Dreharbeiten erstreckte sich vom August 2003 bis zum Februar 2004.
Zu Beginn hielt sich das Team auf Korsika auf, wechselte aber dann nach
Paris und seine Umgebung über, wo die Arbeit erst richtig begann.
Auch in der Bretagne drehte Jeunet mit seiner Crew, bevor es dann in
die Schützengräben von Poitiers ging. Zum Abschluss des Films
wurden noch Szenen in den Bry-sur-Marne- Studios gedreht. Auch in diesem
Film wird die unverkennbare Handschrift Jeunets sichtbar - sein Hang
zur pedantisch genauen und detaillierten Vorbereitung der Aufnahmen.
Vor Beginn der "echten" Filmaufnahmen sondierte Jeunet mit seiner Handkamera
das Set um festzustellen, ob die Bildausschnitte und Kameraführungen
tatsächlich so funktionieren, wie es im Drehbuch von ihm vorgesehen
war.
Für
die 200 Uniformen der Soldaten benötigte man zweieinhalb Kilometer
himmelblauen Stoff, der eigens dafür gewebt wurde. Der Zeitraum
der Dreharbeiten erstreckte sich vom August 2003 bis zum Februar 2004.
Zu Beginn hielt sich das Team auf Korsika auf, wechselte aber dann nach
Paris und seine Umgebung über, wo die Arbeit erst richtig begann.
Auch in der Bretagne drehte Jeunet mit seiner Crew, bevor es dann in
die Schützengräben von Poitiers ging. Zum Abschluss des Films
wurden noch Szenen in den Bry-sur-Marne- Studios gedreht. Auch in diesem
Film wird die unverkennbare Handschrift Jeunets sichtbar - sein Hang
zur pedantisch genauen und detaillierten Vorbereitung der Aufnahmen.
Vor Beginn der "echten" Filmaufnahmen sondierte Jeunet mit seiner Handkamera
das Set um festzustellen, ob die Bildausschnitte und Kameraführungen
tatsächlich so funktionieren, wie es im Drehbuch von ihm vorgesehen
war. Zunächst
wurde der verkehrsleere Platz gefilmt, dann auf dem Außengelände
eines Automobil-Testcenters mit allen Oldtimer Gefährten der damaligen
Zeit gedreht. Zum Schluss drehte man noch eine Szene im Büro des
Detektivs Germain Pire ab. Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen
an Jeunet und sein Team wurde niemals die emotionale Seite der Handlung
und Romanvorlage außer acht gelassen, wenngleich der Film sich
im Ablauf ausschließlich an der Realität orientiert. Da bilden
natürliche Geräusche wie die Meeresbrandung an der bretonischen
Küste und der abstrakte Kampflärm an der Front bildbeeinflussende
Gestaltungsmittel von elementarer Wucht. Beinahe zart und verloren dagegen
die Bemühungen Mathildes der Tuba einige Töne zu entlocken,
die hinaushallen in die Welt der Schützengräben und Granattrichter
und immer wieder den Namen ihres Verlobten rufen - Manech - wo bist
du? Manech - ich warte auf dich. Sieben lange Jahre sucht, hofft und
wartet Mathilde auf die Rückkehr ihres Verlobten Manech - vergebens.
Zunächst
wurde der verkehrsleere Platz gefilmt, dann auf dem Außengelände
eines Automobil-Testcenters mit allen Oldtimer Gefährten der damaligen
Zeit gedreht. Zum Schluss drehte man noch eine Szene im Büro des
Detektivs Germain Pire ab. Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen
an Jeunet und sein Team wurde niemals die emotionale Seite der Handlung
und Romanvorlage außer acht gelassen, wenngleich der Film sich
im Ablauf ausschließlich an der Realität orientiert. Da bilden
natürliche Geräusche wie die Meeresbrandung an der bretonischen
Küste und der abstrakte Kampflärm an der Front bildbeeinflussende
Gestaltungsmittel von elementarer Wucht. Beinahe zart und verloren dagegen
die Bemühungen Mathildes der Tuba einige Töne zu entlocken,
die hinaushallen in die Welt der Schützengräben und Granattrichter
und immer wieder den Namen ihres Verlobten rufen - Manech - wo bist
du? Manech - ich warte auf dich. Sieben lange Jahre sucht, hofft und
wartet Mathilde auf die Rückkehr ihres Verlobten Manech - vergebens.