|
Brustkrebspatientinnen
stürmen den Gipfel
Wie mit modernen Therapien immer mehr Patientinnen geheilt werden können
Christiane Dierks aus Hamburg hat einen der höchsten Berge der
Welt bestiegen, den Mount Aconcagua in Chile. Noch vor vier Jahren schien
dies völlig unmöglich: Sie hatte Brustkrebs. Heute führt
die 39-Jährige ein ausgefülltes, glückliches Leben. 
Kurz vor der Jahrtausendwende kam für die junge Frau der Schock:
Ein Knoten in der rechten Brust. Die Mammographie und die anschließende
Operation brachten die schreckliche Gewissheit – Brustkrebs. Es folgte
der Verlust der Brust und eine Chemotherapie. Eine Schwangerschaft musste
unterbrochen werden. Doch die 35-jährige Christiane Dierks gab
nicht auf und kämpfte. Sie meisterte ihr Schicksal mit Optimismus
und Humor. Und sie nahm die Krankheit zum Anlass, ihr bisheriges Leben
zu überdenken, ihren beruflichen Stress auf den Prüfstand
zu stellen und sich zu einem mutigen Schritt zu entschließen.
Sie besann sich auf ihre eigentlichen Wünsche und Stärken
und gründete ihr eigenes Unternehmen: The Image Institute. Heute
berät Christiane Dierks Firmen und Einzelpersonen in Image- und
Stilfragen und ist sehr erfolgreich. 
Und sie stellte sich einer weiteren Herausforderung: Mit acht weiteren
ehemaligen Brustkrebspatientinnen aus ganz Europa bestieg sie im Februar
2004 einen der höchsten Berge der Welt: den 6962 Meter hohen Mount
Aconcagua in Chile. Mit dieser ambitionierten und Aufsehen erregenden
Aktion wollten sie und ihre Mitstreiterinnen anderen betroffenen Frauen
zeigen, dass die Krankheit nicht das Ende bedeutet. Brustkrebs darf
kein Tabu und kein Stigma sein. Frauen nach Brustkrebs sind genauso
leistungsfähig wie vor der Erkrankung. Das Leben verändert
sich, aber es geht weiter voran.
Chance auf Heilung im 3. Jahrtausend:
Wirksame Medikamente frühzeitig einsetzen
Möglich wird dies auch durch Fortschritte in der Krebstherapie.
Moderne Medikamente bieten heute eine immer bessere Chance auf Heilung.
So wurden kürzlich auf dem größten internationalen Brustkrebskongress
in San Antonio, Texas, die Ergebnisse der BCIRG 001-Studie (Breast Cancer
International Research Group) vorgestellt. Sie zeigen, dass mit dem
frühzeitigen Einsatz des Krebsmedikamentes Taxotere (Wirkstoff
Doctaxel) im Vergleich zur Standardtherapie die Überlebensraten
bei Brustkrebs im Frühstadium deutlich verbessert und die Wahrscheinlichkeit
eines Rückfalls nachhaltig reduziert werden können.
Frauen mit befallenen Achsellymphknoten, die nach der Operation Docetaxel
erhielten, hatten nach einer Beobachtungszeit von 55 Monaten ein um
28 Prozent geringeres Risiko eines Rückfalls als Frauen, die mit
der Standardtherapie behandelt wurden. Für Deutschland bedeutet
dies, dass durch eine Docetaxelhaltige Kombinationstherapie pro Jahr
zusätzlich etwa 1.700 Patientinnen rückfallsfrei überleben
könnten – Frauen wie Christiane Dierks.
Neben der Verringerung des Rückfallrisikos um 28 Prozent ergab
die Studie auch, dass durch den Einsatz von Docetaxel die Wahrschein-lichkeit,
an der Erkrankung zu versterben, um 30 Prozent gesenkt werden konnte.
Dieser Überlebensvorteil ist dabei unabhängig von der Anzahl
der befallenen Lymphknoten und unabhängig vom Hormonrezeptor- und
HER-2/neu-Status des Tumors.
Über Aventis
Aventis erforscht und entwickelt innovative, verschreibungspflichtige
Medikamente zur Behandlung und Prävention von ernsten Erkrankungen
sowie Impfstoffe. Im Jahr 2003 erzielte Aventis in seinem Kerngeschäft
einen Umsatz von 16,79 Milliarden Euro, investierte 2,86 Milliarden
Euro in Forschung und Entwicklung und beschäftigte weltweit rund
69.000 Mitarbeiter. Der Unternehmenssitz ist in Straßburg, Frankreich.
Weitere Informationen im Internet: http://www.aventis.com.
Wie immer
mehr Frauen den Krebs besiegen
Dr. med. Björn W. Lisboa, Hamburg
 Das
Mammakarzinom ist in Deutschland mit etwa 50.000 Neuerkrankungsfällen
(1998) nach wie vor der häufigste bösartige Tumor der Frau.
Die Häufigkeit ist seit den sechziger Jahren deutlich angestiegen,
wobei es allerdings keinen schlüssigen Beweis dafür gibt,
dass von diesem Trend jüngere Frauen überproportional betroffen
wären. Auch bei der Sterblichkeit ist Brustkrebs die häufigste
Ursache. Seit kurzem zeigt sich aber auch in Deutschland eine Trendwende,
wie sie in den angelsächsischen Ländern schon seit Begin der
neunziger Jahre zu beobachten ist: Die Sterblichkeit nimmt ab, was durch
eine verbesserte Früherkennung, aber auch durch moderne adjuvante
medikamentöse Therapien erklärt wird. Das
Mammakarzinom ist in Deutschland mit etwa 50.000 Neuerkrankungsfällen
(1998) nach wie vor der häufigste bösartige Tumor der Frau.
Die Häufigkeit ist seit den sechziger Jahren deutlich angestiegen,
wobei es allerdings keinen schlüssigen Beweis dafür gibt,
dass von diesem Trend jüngere Frauen überproportional betroffen
wären. Auch bei der Sterblichkeit ist Brustkrebs die häufigste
Ursache. Seit kurzem zeigt sich aber auch in Deutschland eine Trendwende,
wie sie in den angelsächsischen Ländern schon seit Begin der
neunziger Jahre zu beobachten ist: Die Sterblichkeit nimmt ab, was durch
eine verbesserte Früherkennung, aber auch durch moderne adjuvante
medikamentöse Therapien erklärt wird.
Brustkrebs ist nicht eine isolierte Erkrankung der Brust, sondern eine
Erkrankung, die den ganzen Körper betrifft. Schon im frühen
Erkrankungsstadium können sich einzelne Tumorzellen vom Primärtumor
ablösen und über die Blutbahn oder das Lymphsystem andere
Organe im Körper erreichen, um dort Tochtergeschwülste, so
genannte Metastasen zu bilden. Deshalb ist es oftmals nicht ausreichend,
nur den Tumor aus der Brust operativ zu entfernen.
Die so genannte adjuvante Therapie ist eine medikamentöse Zusatzbehandlung,
die darauf abzielt, verstreute Tumorzellen im Körper zu zerstören.
Hierdurch kann das Risiko eines Rückfalls (Rezidives) gesenkt,
die Heilungschancen somit deutlich verbessert werden. So ist es möglich,
bei Frauen, deren Tumor Hormonrezeptor-positiv ist, eine sehr effektive
Nachbehandlung mit antiöstrogenen Substanzen durchzuführen.
Das wichtigste Medikament ist bisher das Tamoxifen. Über einen
Zeitraum von 5 Jahren eingenommen führt Tamoxifen nach 15 Jahren
zu einem absoluten Überlebensvorteil von 9 %.
Neben der antihormonellen Therapie hat gerade bei jüngeren Frauen
die Chemotherapie einen hohen Stellenwert. Hierbei werden Zellgifte
verabreicht, welche im Körper verstreute Tumorzellen zerstören
sollen. Ziel jeder adjuvanten Therapie ist die vollständige Heilung
der Patientin. Der Gewinn für die Patientin wird in der Regel als
relative Reduktion des Risikos eines Rückfalls bzw. Wiederkehr
der Erkrankung bezeichnet. Der absolute Gewinn steigt mit zunehmendem
Risiko, d.h. in der Regel gilt: Je größer das Risiko, desto
größer der Gewinn für die Patientin.
Chemotherapien werden heute als Polychemotherapien gegeben. Es werden
also verschiedene Wirkstoffe, die sich gegenseitig ergänzen, kombiniert.
Große Therapiestudien haben gezeigt, dass beispielsweise durch
die am längsten bekannte Kombinationstherapie CMF eine Senkung
der Sterblichkeit um absolut 4,6 % erreicht werden kann. Durch den Einsatz
von neueren Substanzen aus der Gruppe der Anthrazykline konnte eine
weitere Risikoreduktion in etwa der gleichen Größenordnung
erreicht werden. Heute gelten deshalb anthrazyklinhaltige Kombinationstherapien
als der Standard in der medikamentösen Zusatzbehandlung.
Seit einigen Jahren stehen mit den so genannten Taxanen Medikamente
aus einer völlig neuen Substanzgruppe zur Verfügung. Diese
Chemotherapeutika, welche ursprünglich aus der Eibe gewonnen wurden,
haben sich in der Behandlung der fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung
längst bewärt. Nun gibt es seit kurzem auch Daten aus ersten
Studien, in welchen diese neuen Substanzen mit der heutigen Standardtherapie
verglichen wurden. In einer dieser Studien wurde das Medikament Taxotere
in einer Kombinationstherapie mit dem anthrazyklinhaltigem FAC-Standardschema
verglichen. Es zeigte sich eine signifikante Verbesserung sowohl hinsichtlich
des rezidivfreien, als auch des Gesamtüberlebens bei den Patientinnen,
welche die taxanhaltige Therapie erhalten hatten.
Diese viel versprechenden Ergebnisse machen Mut und geben Anlass zu
der Hoff-nung, dass sich die Heilungschancen von Brustkrebspatientinnen
durch einen frühzeitigen Einsatz von Taxanen in der Primärtherapie
des Mammakarzinoms noch weiter verbessern lassen. Für welche Patientinnen
diese Therapie besonders sinnvoll sein kann, wird derzeit in mehreren
klinischen Studien untersucht.
Backgrounder
zur Zytostatikatherapie:
Taxane – Zytostatika aus der Eibe
 Einer
der Grundpfeiler bei der Behandlung von Brustkrebs (Mammakarzinom) ist
neben der Operation die Chemotherapie. Dabei werden so genannte Zytostatika
eingesetzt, die als Zellgifte in den Zellzyklus eingreifen und damit
verhindern, dass sich die Krebszellen weiter teilen. Mit der Chemotherapie
sollen eventuell im Körper verbliebene Krebszellen abgetötet
und ein erneutes Wachstum des Tumors (Rezidiv) oder Tochtergeschwülste
(Metastasen) verhindert werden. Um möglichst alle Krebs-zellen
zu eliminieren, werden heute häufig verschiedene Zytostatika miteinander
kombiniert. Damit lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen die
Wirksamkeit deutlich steigern. Das geht aber nicht selten auf Kosten
der Verträglichkeit. Es wird deshalb intensiv an der Entwicklung
neuer Wirkstoffe gearbeitet, um eine gezieltere und gleichzeitig verträglichere
Chemotherapie anbieten zu können. Einer
der Grundpfeiler bei der Behandlung von Brustkrebs (Mammakarzinom) ist
neben der Operation die Chemotherapie. Dabei werden so genannte Zytostatika
eingesetzt, die als Zellgifte in den Zellzyklus eingreifen und damit
verhindern, dass sich die Krebszellen weiter teilen. Mit der Chemotherapie
sollen eventuell im Körper verbliebene Krebszellen abgetötet
und ein erneutes Wachstum des Tumors (Rezidiv) oder Tochtergeschwülste
(Metastasen) verhindert werden. Um möglichst alle Krebs-zellen
zu eliminieren, werden heute häufig verschiedene Zytostatika miteinander
kombiniert. Damit lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen die
Wirksamkeit deutlich steigern. Das geht aber nicht selten auf Kosten
der Verträglichkeit. Es wird deshalb intensiv an der Entwicklung
neuer Wirkstoffe gearbeitet, um eine gezieltere und gleichzeitig verträglichere
Chemotherapie anbieten zu können.
Taxane stoppen die Zellteilung und damit zugleich das Tumorwachstum
Bei der Suche nach neuen wirksamen Zytostatika ist die Natur den Forschern
zur Hilfe gekommen. Denn es hat sich gezeigt, dass Inhaltsstoffe der
Eibe, die so genannten Taxane, in der Lage sind, die Teilung von Zellen
zu hemmen. Werden Krebszellen mit diesen Substanzen behandelt, so können
sie sich nicht mehr vermehren, der Tumor wird in seinem Wachstum gestoppt.
In vielen Fällen kann durch die Gabe von Taxanen wie dem Wirkstoff
Docetaxel (Taxotere®) das Tumorwachstum tatsächlich aufgehalten
werden. Seit einigen Jahren wird Docetaxel in der Behandlung von Brustkrebs
eingesetzt, entweder allein (Monotherapie) oder auch in Kombination
mit herkömmlichen Zytostatika wie bei-spielsweise dem Anthrazyklin
Doxorubicin.
Docetaxel-Kombination – schnell und gut wirksam
 Bald zeigte
sich anhand von Studien, dass die Kombination von Docetaxel und Do-xorubicin
eine sehr wirksame Behandlungsform ist und als Standardtherapie in der
Erstbehandlung von Frauen mit fortgeschrittener Brustkrebserkrankung,
wenn also bereits Tochtergeschwülste (Metastasen) vorliegen, eingesetzt
werden kann. Bald zeigte
sich anhand von Studien, dass die Kombination von Docetaxel und Do-xorubicin
eine sehr wirksame Behandlungsform ist und als Standardtherapie in der
Erstbehandlung von Frauen mit fortgeschrittener Brustkrebserkrankung,
wenn also bereits Tochtergeschwülste (Metastasen) vorliegen, eingesetzt
werden kann.
Aufgrund der Ergebnisse einer großen Untersuchung mit
429 Brustkrebs-Betroffenen hat die europäische Arzneimittelkommission
diese neue Kombination für die Therapie der Erkrankung im metastasierten
Stadium zugelassen. In der Studie wurde bei 60 % der mit Docetaxel und
Doxorubicin behandelten Frauen das Tumorwachstum gestoppt oder der Tumor
bildete sich sogar zurück. Bei der herkömmlichen Behandlung
war dies jedoch nur bei 47 % der Fall. Auch dauerte es unter dem Taxan
im Durchschnitt eindeutig länger als in der Vergleichsgruppe, bis
die Erkrankung fortschritt.
Trotz der besseren Behandlungsergebnisse wurden jedoch nicht mehr Nebenwirkungen
registriert, die Verträglichkeit der Zytostatika war in beiden
Gruppen vergleichbar. Die Behandlung mit Docetaxel hat darüber
hinaus für die Frauen einen weiteren Vorteil: Eine Klinikeinweisung
ist nicht notwendig, die Therapie kann ambulant durchgeführt und
in den normalen Alltag integriert werden.
Heilungsrate gesteigert: Über 30 % weniger Rückfälle
und über 50% we-niger Todesfälle
In laufenden Studien wird derzeit geprüft, ob sich die gute Antitumor-Wirkung
von Docetaxel möglicherweise dazu nutzen lässt, frühzeitig
die Heilungschancen von Frauen mit Brustkrebs zu erhöhen, indem
das Zytostatikum schon in frühen Stadien der Erkrankung gegeben
wird. Man spricht dann von einer so genannten adjuvanten, also die Operation
unterstützenden Chemotherapie.
Eine Aufsehen erregende Botschaft des internationalen Krebskongresses
in den USA (Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology;
ASCO) im Mai 2002 war zweifellos das von Experten bereits erwartete
Ergebnis nach einer dreijährigen Nachbeobachtungs-Phase der breit
angelegten internationalen BCIRG 001-Studie unter Leitung von Professor
Jean Marc Nabholtz, Los Angeles/Kalifornien, USA. Das Ziel der Studie
war, die Rückfall-Häufigkeit und das Heilungspotenzial einer
Kombi-nationsbehandlung mit Docetaxel zu untersuchen und mit der derzeit
üblichen Standardtherapie zu vergleichen. 1.491 Patientinnen aus
20 Ländern und weltweit 111 Kliniken nahmen an der Studie teil.
Die Ergebnisse belegen eindrucksvoll, dass eine Chemotherapie mit Docetaxel
im Frühstadium des Mammakarzinoms das Risiko eines Rückfalls
gegenüber der stan-dardmäßig durchgeführten Chemotherapie
um 32 % senkt. Mit der Docetaxel-Kombination ließe sich also jeder
dritte Rückfall verhindern. Auf Deutschland übertragen könnten
etwa 2.800 Brustkrebs-Patientinnen mehr durch den konsequenten Einsatz
einer solchen Therapie geheilt werden.
Chemotherapie vor der Operation – Tumorrückbildung und Erhalt
der Brust
Auch der Einsatz von Docetaxel vor der Operation wird geprüft (neoadjuvante
oder primär systemische Chemotherapie). Die in Deutschland durchgeführte
GEPARDUO-Studie (German Preoperative Adriamycin Docetaxel-Studie) konnte
belegen, dass die präoperative Behandlung mit der Docetaxelhaltigen
Kombinati-onstherapie 10 % mehr brusterhaltende Operationen ermöglicht
als herkömmliche Therapieformen: bei 76 % der Patientinnen musste
die betroffene Brust nicht amputiert werden. In 90 % der Fälle
bildete sich der Tumor zurück und bei mehr als 20 % verschwand
er völlig. Die Nachfolge-Studie GEPARTRIO läuft derzeit, eine
Teilnahme ist noch möglich. Weitere Informationen unter www.gabg.de).
Die Andenexpedition hat mir gezeigt, wie stark ich bin
Christiane Dierks, Hamburg
Meine Krankengeschichte
Im Dezember 1999 ertastete ich einen Knoten in meiner rechten Brust.
Bei der Mammographie im Januar 2000 wurden drei Tumore gefunden, die
eine Woche später entfernt wurden. Vier Tage darauf wusste ich,
dass ich schwanger war. Weitere vier Tage später wurde mir die
rechte Brust abgenommen, wobei direkt ein Expander für den späteren
Wiederaufbau der Brust eingesetzt wurde. An die Operation schlossen
sich vier Zyklen einer Chemotherapie mit einem Anthrazyklin an, meine
Schwangerschaft musste abgebrochen werden.
Die Expedition zum Mount Aconcagua
Die Idee zu dieser ungewöhnlich mutigen und ambitionierten Expedition
hatte eine Radioredakteurin aus Belgien, die in ihrem persönlichen
Umfeld mehrfach mit der Erkrankung Krebs konfrontiert worden war. Sie
wollte zeigen, dass Frauen, die den Brustkrebs überstanden haben,
genauso leistungsfähig sind wie andere Menschen. Sie wollte Vorurteile
abbauen und Mut machen. Sie suchte und fand den Kontakt zu neun Frauen
aus ganz Europa, die mit ihr das vermeintlich Unmögliche wagen
wollten. Im August 2003 trafen wir uns zu einem Vorbereitungstraining
in den Schweizer Hochalpen.
Die eigentliche Expedition startete am 5. Februar 2004. In den folgenden
zwei Wochen bestiegen wir gemeinsam mit Bergführern und unserem
Expeditionsarzt den Mount Aconcagua in Chile. Er ist 6.962 Meter hoch.
Der Aufstieg führte uns alle bis an unsere Grenzen, doch wir haben
unser Ziel erreicht: Wir haben gezeigt, dass Frauen nach Brustkrebs
leistungsfähig sind, dass der Krebs uns nicht besiegt hat. Wir
wollen anderen betroffenen Frauen Mut machen: Das Leben ist nicht zu
Ende, es geht weiter und hält große Herausforderungen und
Triumphe bereit. Weitere Informationen zur Expedition unter: www.beyondthewhiteguard.org.
Mein beruflicher Neuanfang
Doch der Krebs hat noch mehr bei mir bewirkt: Eine neue Definition von
Glück und Erfolg. Ich habe mich beruflich verändert und endlich
selbst verwirklicht. Im Jahr 2002 gründete ich „The Image Institute“
in Hamburg und gebe als Imageberaterin erfolgreich Seminare und Einzelcoachings
für Firmen und Privatpersonen (www.the-image-institute.de).
Soll ich mein heutiges Leben und meine Gefühle kurz zusammenfassen,
würde ich sagen: Gestern Brustkrebs. Heute gesund und glücklich!
Backgrounder bei gesicherter Diagnose:
Der Ernstfall – Die Diagnose Brustkrebs ist gesichert
Die Zeit zwischen den verschiedenen Untersuchungen, das Warten auf den Befund – Momente des Hin- und Hergerissenseins zwischen Hoffnung und Angst, Verzweiflung und Mut beherrschen viele betroffene Frauen.
Und dann der Schock: Der Verdacht auf Brustkrebs hat sich bestätigt, die Diagnose steht zweifelsfrei fest, die schlimmsten Befürchtungen sind eingetreten, sind auf einmal real.
Jede Frau verarbeitet die Diagnose anders. Angst vor der Operation, Angst davor, ein wesentliches Attribut der Weiblichkeit zu verlieren, Angst vor einer lebensbedrohlichen Erkrankung werden bei den meisten der von Brustkrebs Betroffenen im Vordergrund stehen.
Sicherlich ist es ratsam, wenn die Betroffene ein wenig Abstand gewonnen hat und der erste große Schock einigermaßen überwunden ist, erneut mit ihrem betreuenden Arzt oder ihrer Ärztin spricht. Sie können Möglichkeiten zeigen, mit der Diagnose umzugehen, wie es den persönlichen Bedürfnissen entspricht. Die Familie, Freunde und Bekannte und auch der Kontakt zu anderen betroffenen Frauen in Selbsthilfegruppen sind mögliche Begleiter auf diesem Weg. Viele Krebspatienten berichten von der Erfahrung, dass ihr Leben unter dem Eindruck der Erkrankung intensiver wurde. Es werden Kräfte mobilisiert, von denen man vorher gar nichts wusste.
Die Diagnose annehmen und das Leben aktiv neu gestalten
Erfahrungsgemäß kommen Frauen mit Brustkrebs auf lange Sicht betrachtet besser mit der Erkrankung zurecht, wenn sie die Diagnose annehmen und sich aktiv an der Bekämpfung der Krankheit beteiligen. Im Idealfall ist die Patientin Partnerin des Arztes im Kampf gegen den gemeinsamen Feind „Brustkrebs“ und nicht nur gleichgültiger „Fall.“
Erster Schritt auf diesem sicherlich manchmal steinigen Weg ist die umfassende Information über die geplante Behandlung, deshalb der Appell an alle Betroffenen: „Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben – kurz: werden Sie Expertin und Ihre eigene Verbündete.“
Backgrounder zur Diagnose:
Brustkrebs – Jeden ertasteten Knoten abklären lassen
Ob ein Knoten in der Brust selbst ertastet wird oder die Veränderung
im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung durch die Ärztin oder den Arzt
aufgespürt wurde: Die erste Reaktion ist Angst, Angst vor Brustkrebs
– in der Fachsprache Mammakarzinom genannt. Brustkrebs ist der häufigste
bösartige Tumor bei Frauen, in Deutschland erkranken pro Jahr etwa
50.000 Frauen. Aber: Brustkrebs ist heilbar, wenn er früh genug
er-kannt und richtig behandelt wird.
Keine wertvolle Zeit verstreichen lassen und den Weg zum Arzt nicht
scheuen, heißt die Devise, wenn ein Knoten getastet wurde. Sehr
häufig sind die Sorgen unbegründet, denn die meisten Knoten
in der Brust – etwa 80 Prozent – sind gutartig und kein Krebs. Um das
jedoch einwandfrei feststellen zu können, müssen einige Untersuchungen
durchgeführt werden.
Zentrale Bedeutung: Mammographie
Heute gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit denen sich auch im
frühen Stadium die Diagnose Brustkrebs sichern oder weitestgehend
ausschließen lässt. Die wichtigste Untersuchungsmethode bei
einer verdächtigen Veränderung der Brust ist derzeit die Mammographie,
also die Röntgenuntersuchung der Brust. Am besten wählen Sie
für die Durchführung der Mammographie eine große Röntgenpraxis
oder die Röntgenabteilung einer Klinik, um sicher zu gehen, dass
die Mammographiebilder von erfahrenen Ärzten beurteilt werden.
Bei dieser Untersuchung werden beide Brüste nacheinander für
einige wenige Se-kunden zwischen zwei strahlendurchlässigen Plexiglasscheiben
möglichst flach zu-sammengepresst. Das ist zwar für einen
Moment unangenehm, aber wichtig, denn je flacher die zu durchleuchtende
Gewebeschicht ist, desto besser sind die Qualität und Aussagekraft
der Röntgenbilder.
Im Mammographiebild kann ein getasteter Knoten besser beurteilt werden:
So gibt es verschiedene Zeichen, die Hinweise für eine bösartige
Veränderung sein können. Aber auch noch nicht tastbare Knoten
lassen sich entdecken: Mit den heutigen Geräten können Tumore
erkannt werden, die kleiner als ein Zentimeter, also in etwa in Reiskorngröße,
sind (Grenze derzeit 5 Millimeter). Und bei den heute verwendeten modernen
Mammographiegeräten ist die Strahlenbelastung nur gering.
Wertvolle Unterstützung: Die Ultraschalluntersuchung
Das Brustgewebe kann auch mit Hilfe der Ultraschall-Untersuchung – medizinisch
Sonographie genannt – sichtbar gemacht werden. Dabei werden keine Röntgen-strahlen,
sondern Ultraschallwellen eingesetzt, die von einem Schallkopf ausgesandt
werden. Der Arzt führt den Schallkopf über die Brust und die
dabei vom Gewebe zu-rück geworfenen Schallwellen werden vom Computer
ausgewertet und erscheinen als Bild auf dem Monitor.
Die Ultraschall-Untersuchung erlaubt eine erste Darstellung eines Knotens
oder einer Zyste – einem mit Flüssigkeit gefüllten Hohlraum
– und ist auch geeignet für eine erste Beurteilung der Brust bei
jüngeren Frauen, bei denen das Brustdrüsengewebe oft sehr
dicht ist und bei der Mammographie eventuell nicht ausreichend durchleuchtet
werden kann. Das Verfahren ist nicht schmerzhaft, eine Strahlenbelastung
besteht nicht, weshalb die Sonographie beliebig oft wiederholt werden
kann. Sie liefert jedoch nur ergänzende Informationen, ihre Aussagekraft
ist geringer als diejenige der Mammographie, weshalb sich die Sonographie
auch nicht als alleinige Methode zur Abklärung eines getasteten
Knotens eignet.
Nur begrenzte Aussagekraft: die Kernspintomographie
Die Kernspintomographie ist ein aufwändiges Verfahren, mit dem
sich das Brustgewebe über Magnetfelder scheibchenweise darstellen
lässt. Die Kernspintomographie kann jedoch keine sicheren Anhaltspunkte
dafür geben, ob ein Knoten gut- oder bösartig ist. Zudem ist
sie zeitaufwändig und teuer, so dass dieses Verfahren nur bei speziellen
Fragestellungen eingesetzt wird.
Gewissheit verschafft die Biopsie
Wenn die Ergebnisse von Mammographie und Ultraschalluntersuchung den
Verdacht auf Brustkrebs erhärtet haben, wird Ihr Arzt zu einer
Gewebeuntersuchung, der so genannten Biopsie, raten. Nur damit kann
letztendlich sicher festgestellt werden, ob ein Knoten tatsächlich
gut- oder bösartig ist.
Heute werden dafür schonende, so genannte minimal invasive Verfahren gewählt, die man in der Regel in lokaler Betäubung und ambulant durchführt. Mit einer sehr dünnen Hohlnadel wird dabei unter Ultraschall- oder Mammographiekontrolle aus dem verdächtigen Herd Gewebe entnommen und an den Pathologen zur Beurteilung durch das Mikroskop geschickt. In der Regel dauert es einige Tage, bis das Ergebnis vorliegt.
Durch die Kombination der verschiedenen Untersuchungsmethoden lässt
sich nicht nur die Diagnose eines Brustkrebses ausschließen oder
sichern, es wird im Falle eines Falles auch bestimmt, in welchem Stadium
sich der Tumor befindet. Dies ist entscheidend für die Therapieplanung
und es ist einer der wichtigsten Einflussfaktoren für die Heilungschancen
bei Brustkrebs.
Backgrounder zur Prophylaxe:
Brustkrebs – Früherkennung ist entscheidend
Brustkrebs – mit dieser schicksalhaften Diagnose werden seit Jahren
mehr und mehr Frauen konfrontiert. Mittlerweile ist Brustkrebs, der
Mediziner spricht vom Mammakarzinom, der häufigste Tumor bei Frauen.
Seine Heilungschancen sind, wie bei den meisten anderen Karzinomen auch,
umso besser, je früher der Tumor erkannt wird. Gerade bei Brustkrebs
haben die Frauen gute Möglichkeiten, durch aktive Vorsorge selbst
zur Früherkennung beizutragen.
Dazu gehören die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt und die monatliche Selbstuntersuchung der Brust. Internationalen Studien zufolge können mehr als 90 % der Frauen, bei denen der Tumor tatsächlich im Frühstadium entdeckt wurde, geheilt werden.
Selbstuntersuchung: den Tastsinn trainieren
Zwar steigt das Risiko mit zunehmendem Alter, dennoch ist der Brustkrebs
keinesfalls auf ältere Frauen beschränkt. Auch schon in jungen
Jahren ist daher die Selbstuntersuchung der Brust von entscheidender
Bedeutung. Wenn die Frau sich nach erlernter Technik regelmäßig
untersuchen, wird sie Ihr Brustgewebe mit der Zeit gut kennen und Normales
von Verdächtigem unterscheiden können. Die Erfahrung zeigt,
dass Frauen, die ihre Brust regelmäßig selbst untersuchen,
Knoten bereits von etwa zwei Zentimetern Durchmesser, also doppelter
Kirschkerngröße, erkennen. Zum Vergleich: Frauen ohne Erfahrung
der regelmäßigen Untersuchung ertasten einen Knoten erst
bei einer Größe von rund 3,5 Zentimeter, was der Größe
einer Walnuss entspricht. Fazit: Übung trainiert den Tastsinn.
Mit einer „professionellen“ Selbstun-tersuchung in Ergänzung zur
Vorsorgeuntersuchung durch den Frauenarzt lässt sich Brustkrebs
im Frühstadium gut erkennen.
Immer zum gleichen Zeitpunkt im Monat untersuchen
Am besten untersuchen Frauen ihre Brust einmal im Monat acht bis zehn
Tage nach dem ersten Tag der Monatsblutung. Dann nämlich ist das
Brustgewebe besonders weich, und Veränderungen lassen sich leichter
tasten. Das gilt auch für Frauen in den Wechseljahren, die eine
Hormonbehandlung erhalten und bei denen die Regelblutung regelmäßig
auftritt. Wenn sie keine Hormone einnehmen und keine Periode mehr haben,
untersuchen sie ihre Brust am besten zu einem festgelegten Termin ebenfalls
einmal im Monat.
Praktisch ist dabei die Untersuchung nach einer fest gelegten Reihenfolge:
1. Beginnen Sie vor dem Spiegel, in dem Sie Ihre Brust kritisch betrachten
und zwar mit gesenkten wie auch mit erhobenen Armen und ein weiteres
Mal mit in die Hüften gestemmten Armen und angespannter Brustmuskulatur.
Es sollte kontrolliert werden, ob sich die Brust verändert hat,
ob eine Seite größer ist oder höher sitzt als die andere,
ob die Haut Dellen aufweist oder die Brustwarzen sich in Form oder Farbe
verändert haben oder voneinander unterscheiden.
2. Auf diese kritischen Blicke auf die Brust folgt die Tastunteruntersuchung
im Stehen oder Sitzen und im Liegen. Dazu streckt man am besten die
Hand der Brustseite, die untersucht werden soll, nach hinten oder legt
sie hinter den Kopf. Mit der anderen Hand wird die Brust mit gerade
und geschlossen gehaltenen Fingern durch leichte, kreisende und tastende
Bewegungen Zentimeter für Zentimeter systematisch abgetastet: einmal
vom Brustbein zur Brustmitte hin, danach von außen zur Brustmitte.
Anschließend sollte parallel von unten nach oben und von oben
nach unten abgetastet werden. Zum Schluss werden die mittleren Bezirke
um den Warzenhof separat untersucht, ebenso wie das Gewebe zwischen
Brust und Achselhöhle und diese selbst.
Bei der Untersuchung im Sitzen oder Stehen bietet es sich an, mit einer
Hand die Brust leicht anzuheben und mit der anderen Hand die Untersuchung
leicht streichend und tastend durchzuführen und abschließend
zu testen, ob sich möglicherweise durch sanften Druck Absonderungen
aus der Brustwarze heraus drücken lassen.
Im Zweifelsfall kann man zusätzlich den Frauenarzt zu Rate ziehen
und sich die beste Technik in der Praxis zeigen lassen. Ergeben sich
bei der Selbstuntersuchung Auffälligkeiten, sollte umgehend ein
Arzt aufgesucht werden.
Regelmäßig zur Krebsvorsorge
Unabhängig von der Selbstuntersuchung sollte jede Frau ab dem 30.
Lebensjahr die vom Gesetzgeber vorgesehenen Krebsfrüherkennungs-Untersuchungen
wahrnehmen. Dabei wird der Frauenarzt nicht nur per Abstrich und klinischer
Untersuchung nach einem Tumor im Bereich der Gebärmutter fahnden.
Auch das sorgfältige Abtasten der Brüste sowie der Achselhöhlen
gehört dazu.
Eine Röntgenuntersuchung, die so genannte Mammographie, ist generell
angezeigt, wenn der Tastbefund auffällig ist, wenn also durch die
Frau oder Ihren Frauenarzt ein Knoten in der Brust aufgespürt wurde.
In solchen Fällen dient die Mammographie, eventuell ergänzt
durch die Ultraschalluntersuchung (Sonographie) zur Abklärung des
Befundes.
Unabhängig davon ist die Mammographie ab dem 40. Lebensjahr alle
zwei Jahre zur Früherkennung empfehlenswert. Denn in der Mammographie
lassen sich bereits Tumore erkennen, die Reiskorn groß sind, also
einen Durchmesser von weniger als einem Zentimeter haben. Die durch
die Mammographie bedingte Strahlenbelastung ist gegenüber ihrem
Nutzen zu vernachlässigen, so die Meinung der Experten.
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten einer Mammographie in folgenden Fällen:
• wenn ein Knoten getastet wurde und der Verdacht auf Brustkrebs besteht.
• wenn Verwandte – Schwester oder Mutter – bereits an Brustkrebs erkrankt sind.
Ein „privates“ Screening, also wenn frau selbst auf Nummer Sicher gehen
will und eine Mammographie durchführen lassen möchte, zahlen
die gesetzlichen Krankenkassen derzeit noch nicht.
Backgrounder zur Therapie:
Behandlung bei Brustkrebs
Jede Brustkrebserkrankung ist anders. Hinter dem Begriff Brustkrebs
verbergen sich verschiedene Arten von Tumoren und Krankheitssituationen.
Und je nachdem wie groß der Tumor ist, welche besonderen Eigenschaften
er aufweist und in welchem Gesundheitszustand die Patientin sich befindet,
wird eine individuell für ihre Bedürfnisse „maßgeschneiderte“
Behandlung zusammengestellt.
Zunächst den “Feind“ genau analysieren
Dafür müssen die Ärzte zunächst ein genaues Profil
des Tumors erarbeiten, denn je genauer sie den Tumor kennen, desto besser
und gezielter können sie ihn bekämpfen. Diese Analyse nennt
man „Klassifizierung“. Dafür sind verschiedene spezielle Untersuchungen
notwendig, bei denen zunächst verschiedene biologische Eigenschaften
des Tumors untersucht werden. Wichtig sind dabei vor allem die folgenden
Fragen:
• Wie ist das Wachstumsverhalten der Krebszellen?
o Sogenanntes Grading
? G1 = langsam wachsend
? G2 = mittelschnell wachsend
? G3 = schneller wachsend
• Besitzen die Krebszellen Bindungsstellen für weibliche Hormone?
o Östrogen/Gestagen-Rezeptor negativ oder –positiv
• Besitzen die Krebszellen Bindungsstellen für bestimmte Wachstumsfaktoren?
Der zweite wichtige Punkt für die Klassifizierung ist die Frage,
wie groß der Tumor ist und wie weit sich die Erkrankung im Körper
ausgebreitet hat, also in welchem Stadium sich der Brustkrebs befindet.
Weltweit hat man sich dabei auf eine international anerkannte Einteilung,
die so genannte TNM-Klassifikation, geeignet. Dabei werden folgende
Faktoren erfasst:
1. Tumorgröße (T)
2. Der Befall benachbarter Lymphknoten (N von lat. Nodus = Knoten)
3. Vorhandensein von Tochtergeschwülsten (Metastasen) im Körper (M)
Tis = Der Tumor befindet sich in seinem frühsten Stadium. Es wird auch Carcinoma in situ genannt.
T1 = Der Primärtumor ist kleiner als 2 cm.
T2 = Der Primärtumor ist 2 – 5 cm groß.
T3 = Der Primärtumor ist bereits größer als 5 cm.
T4 = Tumor jeder Größe mit direkter Ausdehnung in der Nachbarschaft
(Brustwand oder Haut).
N0 = Es sind keine Lymphknoten befallen.
N1 = Metastasen in Lymphknoten der Achselhöhle nachweisbar.
N2 = wie N1, aber untereinander oder in der Nachbarschaft fixiert.
Mx = Eine Beurteilung über das Vorhandensein von Metastasen ist nicht möglich.
M0 = Kein Nachweis von Metastasen.
M1 = Fernmetastasen nachweisbar.
Es gibt viele Behandlungsmöglichkeiten
Rasante medizinische Fortschritte haben die Palette der Behandlungsmöglichkeiten bei Brustkrebs enorm erweitert. Prinzipiell unterscheidet man dabei vier Arten:
• Lokale, örtliche Therapie
o Operation
o Strahlentherapie
• Systemische, im gesamten Körper wirkende Therapie
o Chemotherapie
o Hormontherapie
In den letzten zwanzig Jahren hat man viel über das Wesen der Brustkrebserkrankung
gelernt. Früher dachte man, Brustkrebs betrifft nur die Brust selbst
und es genügt, den Tumor durch eine Operation zu entfernen. Heute
herrscht jedoch unter Experten einhellig die Meinung, dass es sich um
eine Erkrankung handelt, die den ganzen Körper, das ganze „System“
betrifft. Denn auch wenn der Tumor in der Brust noch klein ist, können
kleinste, nicht nachweisbare Krebszellen bereits im Körper verstreut
sein (Tochtergeschwülste, so genannte Mikro-Metastasen).
Diese Erkenntnis führte zu einem grundlegenden Wandel in der Behandlung.
Die Operation ist zwar nach wie vor einer der wichtigsten Pfeiler in
der Therapie, aber allein nicht ausreichend, da sie nur lokal, also
örtlich auf den Tumor begrenzt wirkt. Heute bekommen fast alle
Patientinnen im Anschluss an die Operation eine so genannte systemische
Chemotherapie, die im gesamten Körper wirkt. Damit sollen möglicherweise
bereits verstreute Krebszellen abgetötet werden.
Die Operation: bei zwei Drittel der Patientinnen brusterhaltend
In praktisch jedem Fall wird zunächst eine Operation notwendig
sein, bei der der Tumor möglichst umfassend entfernt wird. Da heißt
nicht zwingend, dass die gesamte Brust entfernt werden muss (Mastektomie).
Bei über zwei Dritteln der betroffenen Frauen kann heute auf die
gefürchtete Brustamputation verzichtet werden, der Anteil so genannter
brusterhaltender Operationen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich
gestiegen.
Bei solchen Eingriffen wird nur der Tumor selbst sowie seine unmittelbare
Umgebung und die benachbarten Lymphknoten in der Achselhöhle entfernt.
Die brusterhaltende Operation kommt allerdings nur in Frage, wenn der
Tumor nicht zu groß und nicht auf die Brustwand übergegangen
ist, ein ausgewogenes Brust/Tumorgrößenverhältnis besteht
und das schonendere Vorgehen die allgemeinen Heilungsaussichten nicht
schmälert. In der Regel schließt sich hier eine Strahlentherapie,
und – je nach Tumorcharakteristika – eine Chemo- und/oder Hormontherapie
an.
Handelt es sich um einen speziellen Tumor, der noch auf die oberflächliche
Auskleidung der Drüsengänge beschränkt ist (Carcinoma
in situ), also ein regelrechtes Frühstadium, so reicht unter Umständen
die alleinige Entfernung des tumorösen Gewebes aus. Eine Chemotherapie
ist in solchen Fällen nicht unbedingt notwendig, doch wird meist
sicherheitshalber das umgebende Gewebe bestrahlt (Strahlentherapie),
um eventuell restliche, nicht sichtbare Tumorzellen sicher zu zerstören.
Bei fortgeschrittener Brustkrebserkrankung wird der Arzt zur Entfernung
der Brust raten. Diese so genannte Mastektomie wird heute aber so durchgeführt,
dass im Anschluss daran der Aufbau einer neuen Brust möglich ist
(Brustrekonstruktion).
Auf Nummer sicher gehen: Die Strahlentherapie
Mit der Strahlentherapie — medizinisch Radiotherapie genannt — sollen
Krebszellen vernichtet werden, die durch die Operation nicht erfasst
worden sind. Damit will man vor allem die Gefahr verringern, dass der
Tumor im unmittelbaren Bereich in der operierten Brust wiederkehrt oder
sich neu bildet; es soll also ein so genanntes Lokalrezidiv verhindert
werden.
Die hoch energetischen Strahlen durchdringen dabei den Körper und
schädigen sowohl gesunde Zellen als auch die Krebszellen. Aber
gesunde Zellen können sich zwischen den Bestrahlungen wieder erholen,
während Tumorzellen nach und nach absterben. Deshalb wird die Bestrahlung
in viele einzelne Sitzungen mit jeweils geringer Strahlendosis aufgeteilt
(fraktioniert), damit sich die gesunden Zellen zwischendurch wieder
„reparieren“ können.
Die Strahlentherapie muss immer durchgeführt werden, wenn brusterhaltend operiert wurde. Nach den Ergebnissen verschiedener Studien weiß man nämlich heute, dass bei Patientinnen ohne Strahlentherapie der Tumor wesentlich häufiger wiederkehrt (Rezidiv). Es gibt darüber hinaus weitere Situationen, in denen der behandelnde Arzt eine Strahlentherapie empfehlen wird.
Durch moderne Geräte und dank einer genauesten Vorbereitung ist
die Strahlentherapie heute sehr viel verträglicher geworden. Nach
dem Motto „so stark wie nötig und so schonend wie möglich“
können heute die eingesetzten Strahlen genau dosiert und gesteuert
werden, so dass nur der betroffene Bereich bestrahlt und umliegendes
gesundes Gewebe weitestgehend geschützt werden kann.
Im Allgemeinen beginnt man mit der Strahlenbehandlung, wenn die Operationswunde
gut verheilt ist, also in der Regel vier Wochen nach dem Eingriff, spätestens
zehn Wochen danach. Sie wird meist ambulant im Krankenhaus oder einer
spezialisierten radiologischen Praxis durchgeführt. Die meisten
Frauen können danach ganz normal wieder arbeiten, zu den häufigsten
Nebenwirkungen gehört jedoch die Müdigkeit, so dass die Patientin
sich in der Zeit – so weit es möglich ist – ein wenig schonen und
ausruhen sollte.
Die gesamte Strahlendosis wird in viele kleine Dosierungen aufgeteilt, weil sie so verträglicher ist. Bestrahlt wird daher im Allgemeinen täglich für wenige Sekunden bis Minuten über einen Zeitraum von fünf bis sechs Wochen.
Kampf gegen den Krebs an jeder Stelle des Körpers: Die Chemotherapie
Mit der Chemotherapie sollen noch nicht erkennbare, kleinste im Körper
verstreute Krebszellen (Tochtergeschwülste, Mikro-Metastasten)
vernichtet werden. Dies geschieht durch so genannte Zellgifte, die Zytostatika.
Sie greifen in den Zellzyklus ein und verhindern damit, dass sich die
Zellen weiter teilen. So kann das Tumorwachstum und das Auftreten von
Tochtergeschwülsten gestoppt werden.
Die Chemotherapie kann prinzipiell zu verschiedenen Zeitpunkten gegeben werden:
1. Vor der Brustoperation (primär systemisch) Damit will man den Tumor so verkleinern, dass brusterhaltend operiert werden kann.
2. Nach der Brustoperation (adjuvant, die Operation unterstützend) Hierbei sollen eventuell im Körper verstreute und versteckte Krebszellen vernichtet werden. Das Ziel der Therapie ist die Heilung.
3. Bei Metastasen (palliativ = lindernd) In diesem Fall sollen durch die Chemotherapie Beschwerden gelindert und das Überleben verlängert werden.
Ob eine Chemotherapie notwendig ist, hängt von vielen verschiedenen
Faktoren ab. Allgemein wird heute so gut wie allen Patientinnen im Anschluss
an die Operation eine adjuvante Chemotherapie empfohlen, da man weiß,
dass die Brustkrebserkrankung den ganzen Körper betrifft und damit
auch entsprechend systemisch behandelt werden muss. In verschiedenen
Studien konnte nachgewiesen werden, dass durch diese adjuvante Chemotherapie
deutlich mehr Frauen geheilt werden können. Meistens werden dabei
mehrere Zytostatika miteinander kombiniert, da man weiß, dass
die Kombination wirksamer ist als eine Substanz alleine.
Behandelt wird nach einem bestimmten Schema, dem so genannten Protokoll,
in dem die Menge der eingesetzten Zytostatika und die zeitlichen Abstände
genau festgelegt sind. Einen Behandlungsabschnitt nennt man Zyklus,
die genaue Anzahl der Zyklen hängt von der jeweiligen Chemotherapie
ab. Zwischen den einzelnen Zyklen liegen Pausen von meist zwei bis vier
Wochen, damit die Medikamente wirken und der Körper sich erholen
kann. Die meisten Zytostatika werden in Form von Infusionen über
eine Vene gegeben, einige können Sie auch als Tablette einnehmen.
Heute werden moderne Zytostatika eingesetzt, die sorgfältig dosiert
viel besser vertragen werden als früher. Trotzdem kann es durch
das Wirkprinzip der Zytostatika zu Nebenwirkungen kommen. Denn diese
Substanzen zerstören leider nicht nur die sich teilenden Krebszellen,
sondern auch verschiedene andere, gesunde und sich rasch teilende Zellen
des Körpers wie zum Beispiel Haarwurzelzellen und Zellen der Mund
und Darmschleimhaut. Das erklärt die typischen Nebenwirkungen wie
zum Beispiel Haarverlust, Entzündungen der Mundschleimhaut und
Durchfall. Die von den meisten Patientinnen besonders gefürchteten
Nebenwirkungen Übelkeit und Erbrechen kann man heute durch die
Gabe von speziellen Medikamenten so gut in den Griff bekommen, dass
sie nur noch sehr selten auftreten.
Behandlung durch Östrogenentzug: die Hormontherapie
Man weiß heute, dass das Wachstum von Brustkrebszellen in den
meisten Fällen unter dem Einfluss von weiblichen Hormonen angeregt
wird, also Östrogenabhängig ist. Ob das der Fall ist, kann
durch den Nachweis von Hormonbindungsstellen – auch Hormonrezeptoren
genannt – im Tumor festgestellt werden, an denen das Östrogen anbindet.
Besitzt der Tumor diese Bindungsstellen, spricht man von einem hormonrezeptor-positiven
Tumor, trifft dies nicht zu, ist der Tumor Hormonrezeptor-negativ.
Bei etwa zwei Dritteln der an Brustkrebs erkrankten Frauen liegt ein
homronrezeptor-positiver Tumor vor. Damit bietet sich eine zusätzliche
Chance, über eine Hormonbehandlung Einfluss auf das Tumorwachstum
zu nehmen. Das wichtigste Ziel ist dabei, die Hormone unwirksam zu machen,
um dem Tumor den Wachstumsreiz zu entziehen. Eine Hormonbehandlung ist
also genau genommen eine Hormonentzugsbehandlung.
Dafür gibt es prinzipiell zwei Ansätze:
1. Behandlung mit Anti-Östrogenen
Anti-Östrogene wie die Wirksubstanz Tamoxifen binden an den Östrogen-Hormonrezeptor
der Tumorzelle, entfalten aber nicht dessen Wirkung; die Tumorzelle
wird damit nicht mehr zum Wachstum angeregt.
2. Ausschalten der körpereigenen Öströgenbildung
Früher erfolgte dies durch die operative Entfernung der Eierstöcke.
Heute werden dazu Medikamente verordnet, die dem Hormon ähnlich
sind, das die Östrogenproduktion der Eierstöcke regelt. Man
nennt diese Substanzen GnRH-Analoga (Gonadotropin Releasing Hormon):
Auch sie binden an die entsprechenden Bindungsstellen an, werden aber
nicht selbst aktiv, so dass die Eierstöcke ihre Arbeit einstellen
und keine Hormone mehr bilden;
oder eine körpereigene Substanz – das Enzym Aromatase – hemmen, die für die Bildung von Östrogenen notwendig ist. Aromatasehemmer blockieren das Enzym, so dass kein Östrogen mehr produziert werden kann.
Ob eine Hormonbehandlung in Frage kommt, hängt von den persönlichen
Umständen ab. Wichtig ist dabei, ob die Patientin vor oder nach
Eintritt der Wechseljahre an Brustkrebs erkrankt sind und ob der Tumor
Hormonrezeptor-positiv ist.
GLOSSAR
Adjuvante Therapie
Adjuvant bedeutet unterstützend. Eine adjuvante Therapie ist jede
unterstützende Behandlungsform, die nach einer bereits vorangegangenen
Therapie – etwa dem chirurgischen Entfernen des Tumors – eingesetzt
wird, um zu verhindern, dass die Erkrankung erneut auftritt. Adjuvant
behandelt wird beispielsweise mit Hormonen (adjuvante Hormontherapie),
mit zellteilungshemmenden Medikamenten, so genannten Zytostatika (adjuvante
Chemotherapie) oder mit Strahlen (adjuvante Radiotherapie).
Altern
Das Lebensalter gilt als wichtiger Risikofaktor für das Entstehen
von Krebs: Je älter ein Organismus ist, desto wahrscheinlicher
werden fehlerhafte Zellteilungen. Aus fehlerhaft abgelaufenen Zellteilungen
gehen häufig genetisch veränderte Zellen hervor, die zu einem
Tumor heranwachsen können. Ein Grund für die Zunahme von genetischen
Fehlern ist, dass die Fähigkeit der Zelle Erbgutschäden zu
beseitigen, altersbedingt nachlässt.
Angiogenese
Die Neubildung von Blutgefäßen. Wenn ein Tumor bis zu einer
Größe von etwa zwei Millimetern herangewachsen ist, muss
er sich an das Blutgefäßsystem anschließen, damit er
Sauerstoff und Nährstoffe erhält und weiter wachsen kann.
Die entarteten Zellen selbst locken neue Blutgefäße zu ihrer
Versorgung an. Die Angiogenese entscheidet also mit darüber, ob
aus einer winzigen Ansammlung genetisch veränderter Zellen eine
große, bösartige Wucherung heranwächst. Krebsforscher
prüfen derzeit intensiv Substanzen, die die Angiogenese hemmen.
Gelänge es, die Neubildung von Blutgefäßen und damit
die Versorgung des Tumors zu unterbinden, könnten Geschwülste
idealerweise in frühen Stadien „ausgehungert“ oder in ihrem Wachstum
gebremst werden.
Antikörper
Körpereigene Abwehrproteine, die von bestimmten Zellen des Immunsystems,
den B-Zellen, gebildet werden, um Krankheitserreger oder andere gefährliche
Fremdkörper aufzuspüren und unschädlich zu machen. Nach
dem Vorbild der Natur hat die Wissenschaft mittlerweile spezielle Antikörpermoleküle,
so genannte monoklonale Antikörper, konstruiert, die sich gegen
Krebszellen richten und sie zerstören sollen. Um die Schlagkraft
dieser Antikörper gegen Krebszellen zu verbessern, wird versucht,
sie mit starken Giften oder strahlenden Substanzen zusätzlich „aufzurüsten“.
Damit das Abwehrsystem des Körpers die fremden Antikörper
nicht schnell eliminiert, werden ihre Proteinstrukturen außerdem
mithilfe gentechnischer Methoden weitestgehend „vermenschlicht“.
Apoptose
Entartete Zellen scheinen auf die natürlichen Signale des Körpers,
die sie zur Apoptose – zum programmierten Zelltod – auffordern, nicht
mehr zu reagieren. Sie verweigern gleichsam Selbstmord zu begehen. Von
der Erforschung dieses jeder Zelle eingebauten, von Genen gesteuerten
Selbstmordprogramms erhoffen sich die Experten neue Ansatzpunkte für
Medikamente. Mittlerweile ist bekannt, dass zahlreiche der bereits vorhandenen
Medikamente, die sich gegen Krebszellen richten (Chemotherapeutika),
deshalb wirken, weil sie das Selbstmordprogramm der entarteten Zelle
anschalten. Im Laufe der Zeit widerstehen die Krebszellen jedoch der
zellzerstörenden Kraft von Chemotherapeutika. Diese „Chemoresistenz“
beruht in vielen Fällen darauf, dass die Krebszellen Strategien
entwickeln, mit denen sie das mit Hilfe der Chemotherapeutika in Gang
gesetzte Apoptose-Programm wieder stoppen können. Eine fehlgesteuerte
Apoptose ist nicht allein für das Entstehen von Krebs, sondern
auch für andere Krankheiten, etwa den Schweregrad eines Herzinfarkts
oder Schlaganfalls, bedeutend. Normalerweise ist die Apoptose jedoch
kein krank machender Prozess. Es handelt sich vielmehr um ein biologisches
Basisprogramm, ohne das sich kein Organismus entwickeln kann. Ein Beispiel
dafür, wie maßgeblich die Apoptose die Entwicklung vielzelliger
Lebewesen beeinflusst, ist die Metamorphose der Kaulquappe zum Frosch:
Der Schwanz der Kaulquappe wird mittels Apoptose bauplangerecht eingeschmolzen.
Auch während der menschlichen Embryonalentwicklung findet programmierter
Zelltod statt: Mit Hilfe der Apoptose sorgt die Natur dafür, dass
sich die zunächst mit „Schwimmhäuten“ ausgestattete Handpaddel
in fünf wohlgestaltete Finger auftrennt.
Ballaststoffe
Für den Menschen unverdauliche Nahrungsbestandteile in Obst und
Gemüse. Sie wirken jedoch anregend auf die Darmperistaltik und
sind deshalb für die Verdauung wichtig. Eine weitere wichtige Funktion
der Ballaststoffe ist, dass sie Krebs erregende Abbauprodukte binden
können. Eine ballaststoffreiche Kost kann vor Krebserkrankungen
des Verdauungstraktes schützen.
Behandlung
Die drei klassischen Säulen der Behandlung von Krebs sind Operation,
Strahlenbehandlung und die medikamentöse Therapie mit zellwachstumshemmenden
Substanzen (Zytostatika). Die älteste und nach wie vor wichtigste
Behandlungsmethode ist die Operation, während der der Tumor möglichst
vollständig aus dem Körper entfernt wird. Die Strahlentherapie
wird häufig ergänzend zur Operation eingesetzt. Eine Behandlung
mit Krebsmedikamenten – eine Chemotherapie – ist im Gegensatz zu Operation
und Bestrahlung nicht auf einen Körperbereich beschränkt,
sondern erfasst den ganzen Organismus (so genannte systemische Therapie).
Wie die Ärztinnen und Ärzte bei der Behandlung vorgehen, richtet
sich in erster Linie nach der Art der Krebserkrankung und danach, ob
und wie weit sie sich im Körper ausgebreitet hat. Die Behandlungsplanung
erfolgt stets individuell. Oft werden verschiedene Behandlungsweisen
miteinander kombiniert – als ein so genanntes multimodales Behandlungskonzept.
Bestrahlung
Für die Strahlenbehandlung nutzt man energiereiche Strahlen. Diese
zerstören die Krebszellen oder hemmen sie in ihrem Wachstum. Eine
der wichtigsten Effekte der Strahlen betrifft die Erbsubstanz: Sie können
das Erbmolekül DNS so schwer schädigen, dass die Zelle stirbt.
In den vergangenen Jahren hat sich die Strahlentherapie in großen
Schritten weiterentwickelt. Zahlreiche Neuerungen – vor allem die Einführung
der Computertechnik in die Bestrahlungsplanung – erlauben es heute,
Tumoren präzise zu treffen und gesundes Gewebe vor der Strahlenwirkung
weitestgehend zu verschonen.
BRCA 1 und 2
BRCA ist die englische Abkürzung für Brustkrebs (Breast Cancer).
BRCA 1 und 2 sind zwei wachstumsregulierende Gene. Defekte dieser beiden
Gene werden für die meisten Fälle von erblichem Brustkrebs
verantwortlich gemacht. Etwa fünf bis maximal zehn Prozent aller
Brustkrebserkrankungen sind erblich bedingt.
Brustkrebs
Die häufigste Krebserkrankung von Frauen in den industrialisierten
Ländern: Bei etwa jeder zehnten Frau wird im Laufe ihres Lebens
Brustkrebs festgestellt. Doch auch Männer können, wenn auch
sehr selten, von Brustkrebs betroffen sein. Die meisten Brustkrebs-Patientinnen
erkranken „spontan“, das heißt, es kann keine einzelne Ursache
benannt werden, die für das Entstehen der Krankheit verantwortlich
ist. Lediglich fünf bis zehn Prozent aller Brustkrebserkrankungen
sind auf erbliche Faktoren zurückzuführen. Die meisten bösartigen
Tumoren – rund 60 Prozent – wachsen im oberen äußeren Quadranten,
also in jenem Teil der Brust, der der Achselhöhle am nächsten
liegt. Heute ist es möglich, nahezu jeden Brustkrebs brusterhaltend
zu operieren. Nur in seltenen Fällen muss noch eine „radikale Mastektomie“
erfolgen, bei der die Brust komplett entfernt wird.
Chemotherapie
Die jüngste Waffe gegen Krebs: Das erste Chemotherapeutikum – eine
chemische Substanz, die Krebszellen zerstört oder in ihrem Wachstum
hemmt – wurde in den 1940er Jahren entwickelt. Seither kamen zahlreiche
weitere wirksame Substanzen hinzu. Mittlerweile gibt es über 50
verschiedene zellteilungshemmende Medikamente (Zytostatika), zahlreiche
weitere Substanzen werden derzeit klinisch erprobt. Das Ziel einer Chemotherapie
ist, auch diejenigen Krebszellen zu erreichen, die sich eventuell im
Körper ausgebreitet haben. Die meisten Chemotherapeutika entfalten
ihre Wirkung in der Steuerzentrale der Zelle, dem Zellkern. Sie schädigen
dort das Erbmolekül. Infolgedessen stirbt die Zelle, oder sie ist
nicht mehr fähig, sich zu teilen. Die Wirkung der Chemotherapeutika
ist nicht allein auf Krebszellen beschränkt. Sie schädigen
auch normale Körperzellen, die sich oft teilen, beispielsweise
die Zellen der Schleimhäute, der Haarwurzeln oder des Knochenmarks.
Daraus ergeben sich die häufigsten Nebenwirkungen einer Chemotherapie:
Störungen im Verdauungstrakt, Haarausfall und veränderte Blutwerte.
Zwischenzeitlich können viele Nebenwirkungen durch Medikamente
oder andere Gegenmaßnahmen gelindert oder ganz verhindert werden.
Ein Beispiel sind neuere Medikamente, die gegen Übelkeit und Erbrechen
wirken.
Chromosomen
Die in jedem Zellkern enthaltenen Strukturen aus DNS (Desoxyribonukleinsäure)
und Eiweißen. Auf dem Erbmolekül DNS sind hintereinander
die Gene aufgereiht, die Eiweiße „verpacken“ die Gene und regulieren
ihre „Zugänglichkeit“. Menschliche Körperzellen enthalten
zwei Chromosomensätze à 23 Chromosomen. Je ein Chromosomensatz
stammt von jedem Elternteil. Insgesamt sind in den Körperzellen
also 46 Chromosomen. In Krebszellen werden häufig veränderte
Chromosomen gefunden: Ursache solcher „Aberrationen“ können beispielsweise
eine Fehlverteilung der Chromosomen während der Zellteilung, der
Verlust einzelner Chromosomenabschnitte oder das unsinnige Vervielfältigen
chromosomaler Regionen sein.
Cisplatin
Eine anorganische Schwermetallverbindung, die häufig als zellteilungshemmendes
Medikament (Chemotherapeutikum) verwendet wird, um Krebs zu behandeln.
Dulbecco, Renato
Italienisch-amerikanischer Biologe und Nobelpreisträger, der das
weltweite Projekt zur Entschlüsselung des menschlichen Erbguts
(Genoms) mit dem Argument vorantrieb, dass man das Rätsel Krebs
nur lösen könne, wenn man sich auf die Gene konzentriere und
deren komplexes Zusammenspiel begreife.
Eibe
Aus Teilen der Eibe stammen wichtige Medikamente zur Therapie von metastasiertem
Brust- und Lungenkrebs. Die Medikamente wirken, indem sie die Zellteilung
gleichsam arretieren: Sie blockieren die so genannten Mikrotubuli, kleine
kontraktile Röhrchen, die benötigt werden, um die Chromosomen
während der Teilung der Zelle auf die beiden entstehenden Tochterzellen
zu ziehen.
Epidemiologie
Die Krebsepidemiologie ist ein wichtiges Forschungsgebiet, das sich
mit der Häufigkeit und Verteilung von Krebserkrankungen befasst.
Typische Fragen von Epidemiologen sind: Wie viele Menschen erkranken
jährlich an Krebs? Welche Krebsarten treten besonders häufig
auf? Welche sind seltener geworden? Gibt es Regionen, wo bestimmte Krebsarten
gehäuft auftreten? Aufgabe der Epidemiologie ist nicht allein die
statistische Bestandsaufnahme. Mit ihren Forschungsarbeiten wollen die
Wissenschaftler auch Ursachen von Krebs aufzeigen und eine bessere Vorsorge
und Früherkennung ermöglichen.
Ernährung
Eine falsche Ernährungsweise – zu viel, zu fett, zu wenig Vitamine
und Mineralien, zu wenig Ballaststoffe aus frischem Obst und Gemüse
– machen die Experten mittlerweile für 25 bis 40 Prozent aller
Krebsfälle verantwortlich. Eine falsche Ernährung ist damit
ein ähnlich großer – und vermeidbarer – Risikofaktor wie
das Rauchen.
Früherkennung
Ziel der Früherkennung ist es, Tumoren in frühen Stadien zu
erkennen, noch ehe erste Symptome auftreten. Denn je rechtzeitiger Krebs
erkannt wird, desto besser sind die Aussichten auf Heilung. An neuen
Techniken, um selbst Vorstufen von Krebs zu erkennen, wird derzeit intensiv
gearbeitet. Ein Beispiel sind so genannte Gen-Chips, mit denen sich
früheste molekulare Veränderungen, etwa die Überaktivität
bestimmter Gene, in Krebszellen nachweisen lassen. Männer ab dem
45. Lebensjahr sollten einmal jährlich die Prostata von einem Arzt
abtasten und die äußeren Genitalien sowie die Haut untersuchen
lassen. Frauen ab dem 20. Lebensjahr wird empfohlen, einmal jährlich
das innere und äußere Genitale untersuchen sowie einen Abstrich
von Gebärmutterhals und Gebärmuttermund durchführen zu
lassen. Zusätzlich vom 30. Lebensjahr an sollte einmal jährlich
eine medizinische Tastuntersuchung der Brust und der Achselhöhlen
sowie eine jährliche Inspektion der Haut stattfinden. In Deutschland
beispielsweise haben alle Versicherten vom 50. Lebensjahr an einen Anspruch
auf eine Tastuntersuchung des Enddarms sowie den Test auf verborgenes
Blut im Stuhl. Ab dem 55. Lebensjahr sollte die Darmspiegelung als Vorsorge-Untersuchung
folgen.
Gene
Ein Gen ist ein Abschnitt des Erbmoleküls DNS (Desoxyribonukleinsäure),
der die Information für die Konstruktion eines Proteins trägt.
Das menschliche Erbgut besteht aus schätzungsweise 30.000 Genen.
Für die Wachstumsregulation einer Zelle sind vor allem zwei Gengruppen
– die „Onkogene“ und die „Tumorsuppressorgene“ – verantwortlich. Wenn
Vertreter dieser beiden wichtigen Genfamilien Schaden erleiden, kann
eine Zelle aus ihrem Wachstumsgleichgewicht geraten und Krebs entstehen.
Gentherapie
Der Versuch, mit Genen zu heilen: Funktionstüchtige Gene sollen
gegen funktionslos gewordene Gene ausgetauscht und so Krankheiten, die
auf fehlerhaften Erbanlagen beruhen, kuriert werden. Die Gentherapie
von Krebs ist bislang nicht aus ihren experimentellen Ansätzen
hinausgekommen.
Haarausfall
Eine häufige Nebenwirkung der Behandlung mit krebszellzerstörenden
Medikamenten (Zytostatika). Die Medikamente greifen nicht nur Krebszellen
an, sondern auch normale Zellen, die sich rasch teilen. Dazu zählen
auch die Zellen der Haarwurzel. Infolge der Schädigung dieser Zellen
können die Haare vorübergehend ausfallen.
Herceptin
Ein neues Medikament, um Brustkrebs zu behandeln. Es handelt sich um
einen Antikörper, der die Bindungsstelle (Rezeptor) für einen
Wachstumsfaktor blockiert. Dieser Rezeptor – er wird fachsprachlich
mit dem KürzelHER2 bezeichnet – kommt auf der Oberfläche von
Zellen vor. Auf einem Teil bösartiger Brusttumorzellen ist dieser
Rezeptor häufiger als auf gesunden Zellen zu finden. Der Antikörper
kann das Wachstum derjenigen Brustkrebszellen verlangsam helfen, die
den Rezeptor in großer Anzahl als Oberflächenmerkmal tragen.
Derzeit ist Herceptin zugelassen, um Patientinnen zu behandeln, deren
Brustkrebs Tochtergeschwülste gebildet hat.
Hippokrates
Lebte um 460 bis 375 v. Chr., gilt als Stammvater der antiken Medizin
sowie als Begründer des ärztlichen Ethos. Er war der erste,
der medizinische Erfahrung und Beobachtungsgabe mit wissenschaftlichem
Denken verband. Er benutzte als Erster den Begriff Krebs (griechisch
„carcinoma“) für die Erkrankung, über die er sich häufig
geäußert hat, unter anderem mit folgendem Satz: „Alle, die
an verborgenen Krebsschäden leiden, lässt man am besten unbehandelt;
denn behandelt gehen sie rasch zu Grunde; unbehandelt hingegen bleiben
sie noch lange Zeit am Leben“.
Histologie
Werden Gewebe mikroskopisch untersucht, sprechen Fachleute von einer
histologischen Untersuchung; werden einzelne Zellen inspiziert, von
einer zytologischen Untersuchung (Zytologie). Die Diagnose Krebs kann
erst dann gestellt werden, wenn der Pathologe bei der mikroskopischen
Untersuchung einer Gewebeprobe Tumorzellen entdeckt.
Hormone
Botenstoffe des Körpers, die in geringsten Konzentrationen wirken.
Auf die von Hormonen übermittelten Signale reagieren nur Organe,
deren Zellen „Aufnahmestationen“ (Rezeptoren) für Hormone tragen.
Von der Zelloberfläche wird die Hormonbotschaft bis zum Zellkern
weitergeleitet. Manche Hormone regen Zellen dazu an, sich zu teilen.
Brustkrebs ist häufig „hormonabhängig“: Das weibliche Geschlechtshormon
Östrogen regt das Wachstum der Krebszellen an. Es gibt mittlerweile
verschiedene medikamentöse Möglichkeiten, die wachstumsstimulierende
Wirkung von Östrogenen auf Brustkrebszellen zu beeinflussen. Dazu
werden beispielsweise Anti-Östrogene verwendet oder Substanzen,
die verhindern, dass Östrogen gebildet wird.
Humangenomforschung
Von der genauen Kenntnis aller Gene des menschlichen Erbguts (humanes
Genom), ihres Zusammenspiels und ihrer Funktion (welche Proteine entstehen
nach den Anweisungen der Gene und welche Aufgaben erfüllen die
Proteine im menschlichen Organismus) erhoffen sich die Forscher ein
tiefes Verständnis der molekularen Krebsentstehung und neue Ansätze,
um die Erkrankung zielgerichtet und besonders schlagkräftig anzugehen.
Hyperthermie
Eine Behandlungsmethode, bei welcher der ganze Körper oder Körperteile
überwärmt werden. Sie wird teils eingesetzt, um die Wirkung
von Chemo- oder Strahlentherapie zu steigern. Der Hyperthermie liegt
die Laborbeobachtung zu Grunde, dass Krebszellen auf Temperaturen über
42,5 Grad Celcius besonders sensibel reagieren und absterben.
Immuntherapie
Eine Behandlungsform, für die Botenstoffe oder Zellen der körpereigenen
Abwehr genutzt werden. Mit ihrer Hilfe soll eine Abwehrreaktion des
Körpers gegen Krebszellen in Gang gesetzt werden. Es handelt sich
um eine experimentelle Therapie; gewisse Erfolge zeigten sich bislang
bei Lymphomen (Krebserkrankungen, die von lymphatischen Zellen ausgehen),
Dickdarm- und Brustkrebs.
Impfstoffe
Einen Impfstoff gegen Krebs zu finden, ist ein sehr altes Ziel der Forscher.
Bereits vor über 100 Jahren wurden erste Impfstoffe erprobt, doch
Erfolge blieben aus. Heute hoffen die Impfstoff-Experten auf das Vorbeugen
von Krebserkrankungen, die mit Infektionen in Verbindung stehen. So
haben sich in Ländern mit hoher Leberkrebsrate Impfungen gegen
das Hepatitis-B-Virus als erfolgreich erwiesen. Möglicherweise
werden in den kommenden Jahren Impfstoffe gegen den Gebärmutterhalskrebs
verfügbar sein. Erste Tests mit Impfstoffkandidaten verliefen viel
versprechend.
Karzinogene
Substanzen, von denen nachgewiesen ist, dass sie Krebs auslösen
oder ihn begünstigen. Sehr viele Karzinogene sind im Tabakrauch
enthalten, darunter starke wie Nitrosamine, Benzol oder polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe.
Karzinogenese
Das schrittweise Entstehen von Krebs. Der mehrstufige Prozess beginnt
mit einer genetisch veränderten Zelle und wird von verschiedenen
„inneren“ (genetische Disposition) und „äußeren“ Einflüssen
(beispielsweise Umweltkarzinogene) begünstigt. In den veränderten
Zellen sammeln sich immer mehr genetische Defekte an, worauf sie natürliche
Wachstumsgrenzen missachten, sich immer mehr auf Kosten gesunder Zellen
vermehren und im Körper ausbreiten.
Killerzellen
Spezielle Zellen des menschlichen Immunsystems, die von Viren befallene
und bösartige Zellen direkt zerstören und weitere Abwehrmaßnahmen
in Gang setzen. Die Wissenschaftler arbeiten derzeit an neuen Methoden,
mit denen die Aufmerksamkeit dieser körpereigenen „Scharfrichter“
gezielt auf Tumorzellen gelenkt werden soll. Dazu nutzen sie beispielsweise
monoklonale Antikörper, die Krebszellen so auffällig präsentieren,
dass sie von den Killerzellen nicht mehr „übersehen“ werden können.
Klinische Prüfungen
Wenn sich eine Substanz in Laborversuchen und in Untersuchungen mit
Tieren als wirksam erwiesen hat, folgen klinische Prüfungen, die
unter Beweis stellen sollen, dass sie auch beim Menschen wirkt. Erst
dann erteilen die Behörden die Zulassung für das neue Medikament.
Klinische Prüfungen müssen strengen gesetzlichen und wissenschaftlichen
Anforderungen genügen. Die Teilnahme an einer solchen Studie ist
freiwillig; Teilnehmer können jederzeit aus einer laufenden klinischen
Studie ausscheiden. Erfahrungsgemäß gelangt lediglich ein
Zehntel der tierexperimentell geprüften Substanzen in die Klinik.
Kombinationstherapie
Der Einsatz mehrerer Verfahren, etwa die Kombination von Chemo-, Strahlen-
und chirurgischer Therapie, um das bestmögliche Behandlungsergebnis
zu erzielen.
Krebsarten
 Die
Medizin unterscheidet rund 200 verschiedene Krebsarten. Trotz dieser
Vielfalt gehen die meisten Krebserkrankungen auf eine gesunde Zelle
zurück, die sich in einem mehrstufigen Prozess in eine Krebszelle
umgewandelt hat. Je nachdem, welche Zellen sich zu Tumorzellen verändern,
entstehen sehr unterschiedliche Krankheiten, die unterschiedlich verlaufen
und unterschiedlich behandelt werden müssen. Die
Medizin unterscheidet rund 200 verschiedene Krebsarten. Trotz dieser
Vielfalt gehen die meisten Krebserkrankungen auf eine gesunde Zelle
zurück, die sich in einem mehrstufigen Prozess in eine Krebszelle
umgewandelt hat. Je nachdem, welche Zellen sich zu Tumorzellen verändern,
entstehen sehr unterschiedliche Krankheiten, die unterschiedlich verlaufen
und unterschiedlich behandelt werden müssen.
Krebsforschung
Interdisziplinär ausgerichtete Forschung, um die Ursachen und das
Entstehen von Krebserkrankungen zu verstehen und neue Ansätze für
eine bessere Diagnose und Therapie zu finden. Im letzten Drittel des
20. Jahrhunderts konnte die Forschung beispielsweise wachstumsstimulierende
und -unterdrückende Gene identifizieren, die bei der Krebsentstehung
eine Rolle spielen. Das National Cancer Institute (NCI) der Vereinigten
Staaten nennt als Hauptgebiete, auf denen künftig wegweisende Entwicklungen
zu erwarten sind: die Genomforschung und Genetik, die molekulare Epidemiologie,
die Zellbiologie, die Immunbiologie, die Immuntherapie und die Bioinformatik.
Lacks, Henrietta
Im Jahr 1949 erlag die Amerikanerin Henrietta Lacks ihrem Tumorleiden,
einem Gebärmutterhalskrebs. Dem Tumorgewebe wurden damals Zellen
entnommen und erstmals in Zellkultur vermehrt. Diese Zellen zeichnen
sich durch eine bislang unbegrenzte Fähigkeit aus, sich zu teilen.
Sie sind gleichsam unsterblich. Die Nachkommen der Zellen aus dem Tumorgewebe
von Henrietta Lacks werden im Laborjargon He-La-Zellen genannt. Sie
zählen zu den Standardsystemen für biochemische und molekularbiologische
Untersuchungen.
Mammographie
Eine Röntgenuntersuchung der Brust. Sie kann Knoten sichtbar machen,
die durch Abtasten nicht zu entdecken sind. Frauen über 40 Jahren
sollten zur Früherkennung von Brustkrebs alle zwei Jahre eine Mammographie
vornehmen lassen. Ein positiver Mammographie-Befund bedeutet aber nicht
zwangsläufig Krebs, sondern macht weitere Untersuchungen notwendig.
Metastasen
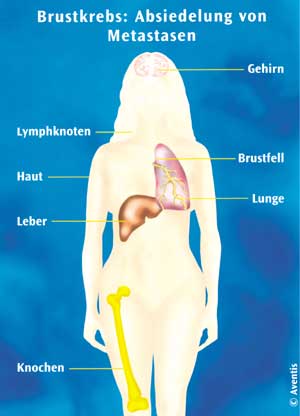 Tochtergeschwulste
des ursprünglichen Tumors in einem anderen Organ. Während
eine gutartige Geschwulst auf ihr Ursprungsgewebe beschränkt bleibt
und sich deshalb relativ leicht entfernen lässt, durchbrechen bösartige
Tumoren die Grenzen zu benachbarten Geweben und verbreiten sich dann
über die Blut- oder Lymphbahnen im Körper. Das Vorhandensein
oder Fehlen von Metastasen ist ein entscheidender Faktor für die
Heilungs- bzw. Überlebenschancen eines Krebspatienten. Schon vor
der Diagnose sind oft Krebszellen des Primärtumors als Metastasen
abgewandert. Oft ruhen sie zeitweise oder gar für immer unentdeckt
in anderen Organen – werden aber sehr gefährlich, wenn sie sich
zu teilen beginnen. Metastasen können manchmal operativ entfernt
werden, etwa in Lunge und Leber. In anderen Organen, etwa im Gehirn
oder in den Knochen, müssen sie durch Bestrahlung bekämpft
werden. Haben sich Metastasen schon an vielen Stellen des Körpers
gebildet, dann bleibt nur die Behandlung mit den Medikamenten, die auch
gegen den Primärtumor wirken. Darmkrebsmetastasen werden dann mit
Darmkrebsmedikamenten behandelt, unabhängig davon, wo sie sich
im Körper angesiedelt haben. Metastasierte Krebserkrankungen sind
oft nicht mehr vollständig zu heilen. Die Behandlung ist dann darauf
ausgerichtet, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die
Symptome zu lindern. Tochtergeschwulste
des ursprünglichen Tumors in einem anderen Organ. Während
eine gutartige Geschwulst auf ihr Ursprungsgewebe beschränkt bleibt
und sich deshalb relativ leicht entfernen lässt, durchbrechen bösartige
Tumoren die Grenzen zu benachbarten Geweben und verbreiten sich dann
über die Blut- oder Lymphbahnen im Körper. Das Vorhandensein
oder Fehlen von Metastasen ist ein entscheidender Faktor für die
Heilungs- bzw. Überlebenschancen eines Krebspatienten. Schon vor
der Diagnose sind oft Krebszellen des Primärtumors als Metastasen
abgewandert. Oft ruhen sie zeitweise oder gar für immer unentdeckt
in anderen Organen – werden aber sehr gefährlich, wenn sie sich
zu teilen beginnen. Metastasen können manchmal operativ entfernt
werden, etwa in Lunge und Leber. In anderen Organen, etwa im Gehirn
oder in den Knochen, müssen sie durch Bestrahlung bekämpft
werden. Haben sich Metastasen schon an vielen Stellen des Körpers
gebildet, dann bleibt nur die Behandlung mit den Medikamenten, die auch
gegen den Primärtumor wirken. Darmkrebsmetastasen werden dann mit
Darmkrebsmedikamenten behandelt, unabhängig davon, wo sie sich
im Körper angesiedelt haben. Metastasierte Krebserkrankungen sind
oft nicht mehr vollständig zu heilen. Die Behandlung ist dann darauf
ausgerichtet, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die
Symptome zu lindern.
Mistel
Schon die keltischen Druiden schrieben der Mistel Heilkraft zu. Daran
knüpfte Rudolf Steiner an. Der Begründer der Anthroposophie
empfahl die Mistel entsprechend der antiken Signaturlehre für die
Krebstherapie, weil sie als Schmarotzer auf Bäumen lebe und damit
dem Krebs ähnlich sei. Wie und ob Mistelextrakte zur Behandlung
von Krebs geeignet sind, ist heftig umstritten. Die Befunde in der Fachliteratur,
die nicht immer wissenschaftlichen Ansprüchen genügen, reichen
von hochwirksam bis völlig wirkungslos. Einzelne Inhaltsstoffe
der Mistel scheinen aber wirksam zu sein. Insbesondere den Lektinen
wird eine Hemmung der Metastasierung zugeschrieben, die jedoch nicht
bewiesen ist.
Mutationen
Veränderungen der Erbinformation, die entweder ein Gen, ein ganzes
Chromosom oder Teile des gesamten Genoms betreffen. Mutationen können
spontan (z.B. durch Fehler bei der Zellteilung) oder durch exogene Einflüsse
(z.B. Chemikalien oder UV-Strahlen) entstehen. Mutationen in Keimzellen
werden vererbt – an der Entstehung von Tumoren sind aber meist somatische
Mutationen einzelner Gene in normalen Körperzellen beteiligt. Dabei
wird die Reihenfolge der vier Basenbuchstaben, in denen die Erbinformation
codiert ist, verfälscht. Das kann beim Abschreiben und Übersetzen
der Erbinformation zum Bau falscher Proteinprodukte führen – und
ein harmloses Wundheilungsprotein in einen hemmungslosen Wachstumsfaktor
verwandeln. Gesunde Zellen erkennen eine Mutation in der Regel rechtzeitig
und beheben den Fehler in routinemäßigen Reparaturverfahren.
Eine Mutation allein macht noch keinen Krebs – sie ist nur eine von
vielen möglichen Stufen auf dem Weg der Krebsentstehung.
Naturheilverfahren
Ein anerkanntes Teilgebiet der Medizin. Naturheilverfahren beruhen auf
jahrhundertealten Erfahrungen in der Anwendung von Methoden, die die
körpereigenen Heilkräfte anregen sollen. Diese bedienen sich
– auf der Grundlage einer ganzheitlichen Sicht des Menschen – bevorzugt
natürlich vorkommender Mittel (Licht, Luft, Erde, Wasser, Wärme,
Kälte, Nahrung, Pflanzen). Die klassischen naturheilkundlichen
Verfahren sind: Hydro-Thermotherapie, Ernährungstherapie und Fasten,
innere und äußere Behandlung mit Pflanzen und Pflanzenextrakten,
Bewegungstherapien und Massageformen sowie Ordnungstherapie und Entspannungsmethoden.
Weitere naturheilkundliche Methoden finden sich in der traditionellen
chinesischen Medizin und der traditionellen indischen Medizin (Ayurveda).
In der Krebsmedizin werden Naturheilverfahren häufig als Ergänzung
zur Standardtherapie angewandt. Vorsicht ist aber immer dann geboten,
wenn naturheilkundlich ausgerichtete Therapeutinnen und Therapeuten
behaupten, ihre Methode sei die einzig wahre und mache schulmedizinische
Standardtherapien überflüssig. Wer sich nach einer Krebsdiagnose
auf ein solches unbewiesenes Verfahren einlässt, läuft große
Gefahr, die Bekämpfung seines Tumors mit Methoden von bewiesener
Wirksamkeit verspätet zu beginnen – oft zu spät.
Nuklearmedizin
Nutzt radioaktive Substanzen zur Diagnose oder Therapie. In der Krebsdiagnostik
setzt sie etwa die Positronenemissionstomographie ein, die die Verteilung
radioaktiv markierter organischer Stoffe im Körper schichtweise
darstellt. Bei Schilddrüsentumoren wird die Radiojodtherapie angewandt.
Denn die Schilddrüse nimmt das radioaktive Jod auf und wird dadurch
von innen bestrahlt.
Onkogene
Geschwulst erzeugende Gene, deren Produkte die Zelle unter bestimmten
Bedingungen zu unkontrolliertem, krebsartigem Wachstum treiben. Das
erste Onkogen „Src“ wurde 1970 entdeckt. Onkogene werden durch die Mutation
oder Stimulation von harmlosen und sogar lebenswichtigen Vorstufen aktiviert,
die der Organismus zum Wachstum und für die Wundheilung braucht.
p53
Das Tumorsuppressor-Gen p53 ist der wichtigste Knotenpunkt im Netzwerk
der körpereigenen Krebsabwehr. Normalerweise ist das p53-System
abgeschaltet oder allenfalls im Stand-by-Betrieb. Es wird erst dann
innerhalb einer Zelle aktiviert, wenn diese übermäßig
gestresst oder geschädigt ist. Denn dann besteht die Gefahr von
Genmutationen, die den Zellzyklus stören und zu ungehemmter Teilung
führen. Schon ein einziger Bruch im DNS-Strang reicht aus, um p53
zu aktivieren. Das p53-Protein wird exprimiert und eilt wie ein Notfallhelfer
in den Zellkern, um dort an bestimmten Stellen der DNS die Expression
von Proteinen einzuleiten, die die unkontrollierte Zellteilung stoppen
oder den programmierten Zelltod (Apoptose) auslösen. Die Notfallfunktion
von p53 ist so wichtig, dass es als „Wächter des Genoms“ bezeichnet
wird. Eine Störung dieses Notfallsystems markiert den Beginn von
50 Prozent aller Krebserkrankungen – im Falle von Lungenkrebs sogar
von 95 Prozent.
Palliative Therapie
Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort „palliare“ – „mit einem
Mantel bedecken“ – ab. Im Gegensatz zur kurativen Therapie bezeichnet
er eine Behandlung von unheilbaren Krebserkrankungen, bei der die Linderung
von Schmerzen und anderen Symptomen im Vordergrund steht, um dem Patienten
noch ein halbwegs angenehmes Leben zu ermöglichen.
Pott, Percival
Britischer Arzt, der 1775 zum ersten Mal Krebs als eine Berufskrankheit
beschrieb. Er führte die hohe Hodenkrebsrate unter Londoner Schornsteinfegern
darauf zurück, dass sie sich regelmäßig an mit Ruß
vollgesogenen Stricken in die Kamine abseilten. Weil viele erkrankte
Männer seit ihrer Kindheit nicht mehr als Schornsteinfeger gearbeitet
hatten, schloss Pott auf eine lange Latenzzeit zwischen dem Einwirken
des krebserregenden Stoffes und dem Ausbruch der Erkrankung.
Prävention
Jeder Mensch kann an Krebs erkranken. Es gibt keinen hundertprozentigen
Schutz vor der Krankheit. Dennoch steht es jedem Menschen frei, sein
Leben so zu gestalten, dass sein Krebsrisiko deutlich sinkt. Die wichtigsten
Regeln der Krebsvorbeugung, wie sie im „Europäischen Kodex zur
Krebsbekämpfung“ formuliert sind, lauten: Rauchen Sie nicht! Trinken
Sie nur mäßig Alkohol! Essen Sie täglich viel frisches
Obst, Gemüse und ballaststoffreiche Getreideprodukte! Bewegen Sie
sich ausreichend und hüten Sie sich vor Übergewicht! Setzen
Sie sich nicht übermäßiger Sonnenstrahlung aus! Schützen
Sie sich vor dem Kontakt mit Krebs erregenden Stoffen, indem Sie alle
Sicherheitsvorschriften einhalten! Nehmen Sie an Früherkennungsuntersuchungen
teil und gehen Sie rechtzeitig zum Arzt, falls sie ungewöhnliche
Schwellungen oder andauernde Beschwerden feststellen! Durch die Befolgung
dieser Regeln, so schätzen Experten, könnte die Mehrzahl aller
Krebserkrankungen vermieden werden.
Proteinkinasen
Besetzen wichtige Schlüsselpositionen in der intrazellulären
Kommunikation. Als Enzyme ermöglichen sie die Verknüpfung
anderer Proteine oder Proteinkinasen mit Phosphatgruppen. Dadurch werden
diese aktiviert. Die Hemmung bestimmter Proteinkinasen, die in manchen
Krebszellen das Tumorwachstum fördern, ist ein Ziel der Suche nach
neuen Krebsmedikamenten.
Psychoonkologie
Krebs kann, so wird vermutet, durch seelische Belastungen mit verursacht
werden – andererseits ist eine Krebserkrankung eine enorme seelische
Belastung, für die Betroffenen wie für Angehörige, Ärzte
und Pflegepersonal. Mit beiden Problemen befasst sich die wissenschaftliche
Disziplin der Psychoonkologie. Reproduzierbare Beweise für die
Bedeutung psychischer Belastungen für die Entstehung von Krebs
gibt es bis heute nicht. Zu verschieden sind die individuellen Möglichkeiten,
psychische Krisen zu verarbeiten. Zu hoch ist für die exakten Wissenschaften
auch die Hürde, die vereinzelt immer wieder beschriebene Beziehung
zwischen seelischer Not und Krebs objektiv nachzuvollziehen. Aus Fallstudien,
mögen sie noch so prägnant sein, lassen sich keine generellen
Aussagen ableiten. Mit Sicherheit lässt sich jedoch sagen, dass
aus einer psychischen Krise allein kein Krebs entstehen kann. Die Seele
steuert allenfalls einen Faktor zum Krebsgeschehen bei, etwa über
eine Schwächung der Immunabwehr. Wichtiger für die praktische
Krebsmedizin ist die zweite Säule der Psychoonkologie. Sie kann
dazu beitragen, allen Betroffenen bei der Bewältigung der Belastungen
zu helfen, die eine Krebserkrankung mit sich bringt. Das gilt nicht
zuletzt für die Ärzte und Pflegekräfte im Krankenhaus,
die täglich mit dem Schrecken der Krankheit Krebs konfrontiert
sind und dabei weder ihre Sensibilität für die Patienten noch
ihre Belastbarkeit verlieren dürfen.
Radiologie
Strahlenheilkunde; Fachgebiet der Medizin, das sich mit der Anwendung
verschiedener Strahlungsarten beschäftigt. Die Radiologie hat sich
im Laufe der vergangenen Jahrzehnte in drei Teilgebiete aufgefächert:
die Röntgendiagnostik, die Strahlentherapie (vor allem zur Behandlung
von Tumoren) und die Nuklearmedizin.
Rauchen
Keine andere Ursache von Krebs ist gleichzeitig so eindeutig bewiesen
und so weit verbreitet wie das Rauchen. Fast ein Drittel aller tödlichen
Krebserkrankungen weltweit sind Folgen des Rauchens. Nicht allein Lungenkrebs
wird durch Rauchen verursacht. Auch für Tumoren der Leber, des
Magens, des Kehlkopfes, der Speiseröhre, der Bauchspeicheldrüse,
der Blase und der Gebärmutter sind Raucherinnen und Raucher stärker
empfänglich als Nichtraucher. Im Vergleich zu diesen verkürzen
Raucher – auch durch Herz-Kreislauf-Krankheiten – ihr Leben um bis zu
25 Jahre. Während das Nikotin süchtig macht, sind die direkt
krebserzeugenden Stoffe in Rauch, Teer und Kondensat verborgen.
Rezeptoren
Molekulare Antennen in der Oberfläche von Zellen. Sie nehmen die
Signale extrazellulärer Botenstoffe auf und vermitteln sie ins
Innere der Zelle. Auch die Befehle zum Wachstum und zur Teilung von
Zellen werden über Rezeptoren vermittelt. Koppelt sich eine Zelle
von dieser Befehlskette ab, um ihr Wachstum selbst zu bestimmen, kann
dies der Beginn einer Krebserkrankung sein.
Rezidiv
Rückfall; Wiederauftreten eines Tumors entweder am ursprünglichen
Ort oder an anderer Stelle im Körper.
Risikofaktoren
Die Häufigkeit vieler Krebsarten variiert zwischen verschiedenen
Ländern um weit mehr als das Zehnfache – und jede Krebsart ist
irgendwo auf der Welt selten. Genetische Ursachen dafür sind so
gut wie ausgeschlossen, denn das Krankheitsbild von Einwanderern passt
sich dem Krebsmuster ihrer neuen Heimat schnell an. Daraus folgern Epidemiologen,
dass die meisten Krebserkrankungen prinzipiell zu vermeiden sind, wenn
die entsprechenden Risikofaktoren ausgeschaltet werden. Wenn auch die
globale Variation mancher Krebsarten bisher nicht eindeutig bestimmten
Risikofaktoren zugeordnet werden kann, so gelten die drei Hauptrisikofaktoren
für viele Krebsarten doch längst als gesichert: Rauchen, Übergewicht
und einige onkogene Viren, wobei das Rauchen der weitaus gefährlichste
Risikofaktor ist. Würden in den Vereinigten Staaten alle gegenwärtigen
Raucher aufhören zu rauchen, dann fiele die künftige Krebstodesrate
dieser Gruppe um 60 Prozent.
Rous, Peyton
Der amerikanische Pathologe (1879–1970) zeigte 1911 als erster Forscher,
dass Krebs auch durch Viren ausgelöst werden kann. Das später
nach ihm benannte Virus – Rous Sarcoma Virus – hatte in seinen Versuchen
bei Hühnern Sarkome entstehen lassen. 1966 – als 87-Jähriger
– erhielt Rous für seine Entdeckung den Nobelpreis für Medizin.
Schimmelpilze
Sie enthalten Aflatoxine, die einer der stärksten natürlichen
Krebserreger sind. Schimmelpilze befallen bevorzugt Lebensmittel wie
Nüsse, Getreide oder geräucherten Schinken. Sie können
durch den Befall von Futtermitteln auch in Milch und deren Produkte
gelangen. Sie sind hitzeresistent und für den Verbraucher von Nahrungsmitteln
häufig nicht feststellbar.
Schmerzen
Krebserkrankungen sind heimtückisch, weil sie sich mit wenigen
Ausnahmen nicht rechtzeitig durch Schmerzen bemerkbar machen. So wird
Krebs oft zu spät diagnostiziert. Im fortgeschrittenen Stadium
der Krankheit sind starke Schmerzen dagegen meist das beherrschende
Symptom. Je größer der Tumor wird, desto mehr presst er auf
das umliegende Gewebe, das sich entzündet und Schmerz auslösende
Substanzen freisetzt. Auch Verwachsungen nach Strahlentherapie oder
Operation können den Schmerz auslösen. Besonders ausgeprägt
ist der Krebsschmerz wegen der hoch empfindlichen Knochenhaut bei Knochenmetastasen.
Krebsschmerzen erfordern eine dauerhafte Behandlung, für die die
Weltgesundheitsorganisation einen Dreistufenplan empfiehlt: Zunächst
nicht-opioidhaltige Mittel, die am Ort des Schmerzes wirken, dann leichte
opioidhaltige Präparate, die die Schmerzempfindung im Gehirn dämpfen,
und schließlich starke Opiate wie Morphium.
Schwere Ionen
Die Bestrahlung von Tumoren mit schweren Ionen befindet sich noch im
Stadium der Erprobung. Ionen sind elektrisch geladene Atome. Schwer
sind sie dann, wenn sie relativ mehr wiegen als Wasserstoffionen. Während
elektro-magnetische Strahlung nicht weit genug ins Gewebe eindringen
kann, um tief liegende Tumoren zu treffen, bahnen sich schwere Ionen
wie die von Kohlenstoff und Neon leichter den Weg. Dazu müssen
sie vorher auf einer Kreisbahn beschleunigt worden sein. Dann geben
sie im Tumorgewebe mehr Energie ab als herkömmliche Strahlen. Auch
die Größe des Bestrahlungsfeldes lässt sich zielgenauer
festlegen und steuern, was empfindliche Gewebe im Umkreis schont. Hirntumoren
und Tumoren in der Nähe des Rückenmarks sind deshalb die bevorzugten
Behandlungsziele dieser Bestrahlungsart.
Stress
Obwohl es naheliegend ist, die Entstehung von Krebs auch mit übermäßigem
Stress in Verbindung zu bringen, konnte dieser Zusammenhang bis heute
nicht direkt nachgewiesen werden. Indirekt könnte Stress aber sehr
wohl an der Entstehung von Krebs beteiligt sein: Denn unter übermäßigem
Stress achten viele Menschen nicht auf ihre Gesundheit: Sie essen zu
viel, sie trinken zu viel, sie rauchen zu viel – und setzen sich damit
einem erhöhten Krebsrisiko aus.
Taxane
Eine neuartige Klasse von Krebsmedikamenten, die seit Anfang der 90er
Jahre vor allem gegen Eierstock-, Brust- und Lungenkrebs eingesetzt
werden. Ihr Wirkstoff wurde in einem Naturstoffscreening des amerikanischen
Krebsforschungszentrums NCI in der Rinde der pazifischen Eibe entdeckt.
Weil die Rinden der Bäume den wachsenden Bedarf nicht decken können,
werden die Taxane Docetaxel und Paclitaxel heute halbsynthetisch aus
den schneller nachwachsenden Nadeln anderer Eiben gewonnen. Taxane haben
einen einzigartigen Wirkmechanismus: Sie fördern den Aufbau der
Eiweißfäden (Mikrotubuli), die bei der Zellteilung die identischen
Chromosomenpaare auseinanderziehen – und verhindern dann deren Abbau.
So wird die Zelle mitten in der Teilung blockiert und stirbt ab. Wie
alle Chemotherapeutika haben auch Taxane schwere Nebenwirkungen. Der
Nutzen durch ihre hohe Wirksamkeit wiegt diese Risiken aber auf.
Tomographie
Normale Röntgenbilder sind für die Krebsdiagnostik oft zu
undeutlich, weil sich auf ihnen verschiedene Körperschichten überlagern.
Die Computertomographie ermöglicht es dagegen, eine Schicht nach
der anderen aufzunehmen – der Brustraum wird für eine Gesamtdiagnose
zum Beispiel in 40 Schichten von je acht Millimetern Dicke dargestellt.
Der Patient wird dazu in millimetergenauen Schüben liegend durch
den Tomographen bewegt. Die Röntgenröhre bewegt sich kreisförmig
um seine Längsachse. Von allen Seiten treten fächerförmige
Strahlen durch die jeweilige Schicht und münden in einen gegenüberliegenden
Empfänger. Der Computer errechnet für jeden Strahl den Energieverlust
beim Durchtritt und setzt aus den Daten ein schwarzweißes Bild
des jeweiligen Körperquerschnitts zusammen. Tomographien sind besonders
gut für die Krebsdiagnostik im Gehirn sowie im Brust-, Bauch- und
Beckenraum geeignet.
Tumor
 Sammelbegriff
für eine örtlich umschriebene Zunahme des Gewebevolumens,
der auch für gutartige Schwellungen wie Ödeme und Entzündungen
gilt. Speziell wird der Begriff für Krebsgeschwulste verwendet,
also für ein ungezügeltes und unumkehrbares Überschusswachstum
von körpereigenem Gewebe, bei dem dieses meist seine spezifische
Funktion einbüßt. Sammelbegriff
für eine örtlich umschriebene Zunahme des Gewebevolumens,
der auch für gutartige Schwellungen wie Ödeme und Entzündungen
gilt. Speziell wird der Begriff für Krebsgeschwulste verwendet,
also für ein ungezügeltes und unumkehrbares Überschusswachstum
von körpereigenem Gewebe, bei dem dieses meist seine spezifische
Funktion einbüßt.
Tumormarker
Biochemische Substanzen, die als Erkennungszeichen für bestimmte
Tumoren gelten können. Meist handelt es sich um Zucker-Eiweiß-Moleküle,
die bei Krebserkrankungen im Blut oder in anderen Körperflüssigkeiten
nachweisbar sind. Tumormarker sind insgesamt nur von eingeschränkter
Bedeutung in der Onkologie. Für die Früherkennung von Krebs
gibt es mit zwei Ausnahmen (Leberzellkrebs bei vorgeschädigter
Leber, Prostatakrebs) keine Tumormarker. Zur Verlaufskontrolle einer
Krebstherapie und zur Früherkennung eines Rückfalls werden
Tumormarker besonders bei Dickdarmkrebs, Eierstockkrebs, Prostata- und
Hodenkrebs und beim kleinzelligen Lungenkarzinom eingesetzt. Mit einer
gemeinsamen Bestimmung der Tumormarker CEA und CA 15-3 kann eine Metastasierung
bei Brustkrebs zum Beispiel mit über 80-prozentiger Sicherheit
erkannt werden. Beim Dickdarmkrebs steht die Höhe des CEA-Wertes
in Beziehung zum Tumorstadium. Seine Bestimmung ist daher für die
Nachsorge von Bedeutung.
Tumorsuppressor-Gene
Enthalten Bauanleitungen für Proteine, die die Umwandlung von Körperzellen
in Tumorzellen verhindert. Eines der bekanntesten Tumorsuppressor-Gene
ist p53. Verliert eine Zelle durch Mutation die Schutzfunktion bestimmter
Tumorsuppressor-Gene, kann sie über mehrere Stufen zu einer Tumorzelle
entarten.
Tyrosinkinase
Eine Gruppe der Proteinkinasen, die andere Proteine (oder sich selbst)
durch das Anhängen von Phosphatgruppen an Tyrosinreste aktivieren.
Sie bilden auch den intrazellulären Teil des Tyrosinkinaserezeptorsystems,
über das bevorzugt Signale von Wachstumsfaktoren einlaufen. Das
macht sie zu einem begehrten Ziel der Forschung nach neuen Krebsmedikamenten.
Überlebenschancen
Definitionsgemäß wird ein an Krebs erkrankter Mensch als
geheilt angesehen, wenn er die Diagnose seiner Krankheit um mindestens
fünf Jahre überlebt hat. Dementsprechend beträgt nach
den jüngsten Daten des amerikanischen Krebsforschungszentrums NCI
die durchschnittliche Überlebensrate von Krebspatienten in den
Vereinigten Staaten 62 Prozent. Diese Zahl überdeckt aber die enormen
Unterschiede zwischen den einzelnen Krebsarten. Die Chancen, eine Brustkrebsdiagnose
um 5 Jahre zu überleben, liegen in den Vereinigten Staaten bei
weit über 80 Prozent – von den Lungenkrebspatienten leben dagegen
fünf Jahre nach der Diagnose nur noch rund 15 Prozent. Bei den
meisten Krebsarten ist die Überlebenschance umso größer,
je früher der Tumor diagnostiziert wurde.
Ultraschall
Untersuchungen mit Ultraschallwellen (Sonographie) werden in der Krebsdiagnostik
bevorzugt an weichen Organen wie Leber oder Niere vorgenommen, die nicht
von Knochen verdeckt sind. Denn Knochen lassen überhaupt keinen
Schall durch. Lebermetastasen sind im Ultraschallbild sehr gut zu entdecken.
Umweltgifte
Bei der Entstehung von Krebs können Umweltgifte eine Rolle spielen,
die aber vermutlich geringer ist als ursprünglich angenommen. Zwar
enthalten z.B. Abgase Krebs fördernde Substanzen, die meisten Krebsarten
werden aber nicht primär durch Umweltbelastungen verursacht. Das
gilt nicht, wenn Menschen an ihrem Arbeitsplatz über lange Zeit
mit Karzinogenen wie Schwermetallen, Dioxinen, Asbest oder radioaktiven
Strahlen in Kontakt gekommen sind.
Unkonventionelle Methoden
Alle Behandlungsformen, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nicht bewiesen
ist oder die nicht der klinischen Norm entsprechen, gelten als unkonventionell
oder alternativ. Das bedeutet nicht, dass alle diese Behandlungsformen
unwirksam oder unseriös sind. Viele Krebspatienten – Tendenz steigend
– nutzen unkonventionelle Methoden als Ergänzung zur Standardtherapie.
Dabei laufen sie aber auch Gefahr, Scharlatanen in die Hände zu
fallen. Andererseits halten unkonventionelle Methoden auch Einzug in
die Schulmedizin: So empfiehlt die amerikanische Gesundheitsbehörde
NIH seit 1997 die Akupunktur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen
nach einer Chemotherapie. Das amerikanische Krebsforschungsinstitut
NCI unterstützt derzeit klinische Studien mit Haifischknorpel zur
Behandlung von fortgeschrittenem Brust- und Darmkrebs.
Vektoren
In der Gentherapie – die sich noch immer im experimentellen Stadium
befindet – der Begriff für die Transportmittel bzw. „Genfähren“,
mit deren Hilfe funktionstüchtige Gene in defekte Gewebe eingeschleust
werden. Häufig werden „entschärfte“ Viren benutzt, von denen
man hofft, dass sie kranke Zellen mit gesunden Genen gleichsam anstecken
können.
Virchow, Rudolf
Bedeutender deutscher Pathologe und Politiker (1821–1902). Er begründete
die Zellularpathologie, die er auch auf Krebserkrankungen bezog. Demnach
stammen alle Zellen eines Tumors von einer entarteten Vorläuferzelle
ab. Diese Theorie schien damals revolutionär, war aber richtig
und legte den Grundstein für die moderne Krebsforschung, die Krebs
als eine Krankheit der Zelle ansieht.
Virusforschung
Ein Virus ist im Gegensatz zu einem Bakterium kein Lebewesen, sondern
nur ein Stück Erbinformation in einer Eiweißhülle. Ein
Virus kann sich nicht selbstständig vermehren, sondern muss dazu
eine Wirtszelle überfallen und sie zu seiner Vermehrung zwingen.
Virusbefallene Zellen können sich in Krebszellen verwandeln. Der
detaillierten Beobachtung dieser Umwandlung – und der Identifikation
entsprechender Tumor-Viren – hat die Krebsforschung des 20. Jahrhunderts
entscheidende Fortschritte zu verdanken, etwa bei der Entdeckung von
Onkogenen. Heute gilt als sicher, dass Viren weltweit an der Entstehung
von etwa 15 Prozent aller Krebserkrankungen beteiligt sind. Jedoch erkrankt
nur ein Bruchteil aller Infizierten später an Krebs – und zwischen
der Ansteckung mit dem Virus und dem Auftreten einer Krebserkrankung
liegt ein Zeitraum von 30 bis 50 Jahren! Zu den Viren, die beim Menschen
an der Entstehung von Krebs beteiligt sind, gehören: Das Epstein-Barr-Virus
aus der Gruppe der Herpes-Viren (Pfeiffer’sches Drüsenfieber, verschiedene
Lymphome); die Humanen Papillom-Viren (Gebärmutterhalskrebs) und
Hepatitis-Viren (Leberzellkrebs). In all diesen Fällen ist die
Virusinfektion jedoch nur eines von mehreren Ereignissen in den betroffenen
Zellen, die für die Entstehung von Krebs auftreten müssen.
Vitamin C
Vitamine können, so wird vermutet, manche Krebs erzeugenden Substanzen,
die der Körper aufnimmt, unschädlich machen, bevor diese die
Erbsubstanz angreifen. Von Vitamin C weiß man, dass es vor Nitrosaminen
schützt und freie Radikale schnell abbauen kann. Für eine
gewisse Schutzwirkung der Vitamine A, C und E vor einigen Krebserkrankungen,
etwa des Magens und der Atemwege, gibt es statistische Anhaltspunkte
in epidemiologischen Studien. Bei anderen Krebserkrankungen hingegen,
etwa der Brust oder der Prostata, scheinen Vitamine gar keine Rolle
zu spielen. Vitamine sollten nach einhelligen Empfehlungen von Experten
normalerweise nicht als Tabletten geschluckt, sondern nur über
die natürliche Nahrung aufgenommen werden. Obst, Gemüse und
Getreideprodukte enthalten nämlich noch mehr Schutzstoffe als nur
Vitamine. Weil Vitamin C wasserlöslich ist, helfen hohe Dosen ohnehin
wenig: Der Überschuss wird vom Körper gleich wieder ausgeschieden.
Wachstum
Die Fähigkeit lebender Zellen, die eigene Substanz durch Umwandlung
aufgenommener Stoffe zu vermehren. Krebszellen wachsen oft wurzelförmig
in umliegende Gewebe ein. Dieses invasive Wachstum macht sie bösartig,
weil es operativ nur schwer zu entfernen ist. Gutartiges Wachstum ist
dagegen expansiv, indem es umliegendes Gewebe verdrängt.
Zellabstrich
Entnahme von Zellen mithilfe eines Spatels oder Watteträgers zur
mikroskopischen Untersuchung. Ein Zellabstrich vom Muttermund und Gebärmutterhalskanal
ist eine zuverlässige Untersuchungsmethode zur Früherkennung
von Gebärmutterhalskrebs. Die Methode zur Untersuchung der abgestrichenen
Zellen ist der Pap-Test.
Zellkern
Er enthält vor allem die Erbsubstanz DNS und trennt sie mit einer
doppelten Membran vom Cytoplasma, in dem die meisten Stoffwechselreaktionen
der Zelle stattfinden. Zellen, die einen Zellkern enthalten, heißen
eukaryote Zellen. Bakterien sind dagegen prokaryot und ohne Zellkern.
Zellskelett
Ein Netzwerk aus Proteinfäden (Actin-Filamente und Mikrotubuli),
das das Innere von eukaryoten Zellen kreuz und quer durchspannt. Es
gibt der Zelle sowohl Halt als auch Beweglichkeit. Ohne die Mikrotubuli
wäre die Zellteilung nicht möglich – denn sie bilden den Spindelapparat,
der die Chromosomen gleichmäßig auf die Tochterzellen verteilt.
Dieser Spindelapparat ist der Angriffspunkt der Taxane, einer neuartigen
Gruppe von Krebsmedikamenten.
Zellteilung
Trennung einer Zelle in zwei Tochterzellen. Der Teilung des Kerns und
seiner DNS-tragenden Chromosomen (Mitose) folgt die Teilung des Cytoplasmas
(Cytokinese). Die Zellteilung ist ein äußerst präzise
gesteuerter Vorgang, der bei Krebserkrankungen außer Kontrolle
gerät.
Zytostatika
Eine Gruppe von Chemotherapeutika, die das Wachstum von Krebszellen
stoppen sollen, indem sie, an jeweils verschiedenen Stellen, die Synthese
von Bausteinen der Erbinformation und von Proteinen blockieren. Zytostatika
attackieren bevorzugt schnell wachsende Zellen – und damit nicht nur
Tumorzellen, sondern auch die Zellen des Blut bildenden Systems, des
Immunsystems und des Haut- und Haarepithels. Das erklärt ihre Nebenwirkungen.
Internet: http://www.aventis.com |



 Das
Mammakarzinom ist in Deutschland mit etwa 50.000 Neuerkrankungsfällen
(1998) nach wie vor der häufigste bösartige Tumor der Frau.
Die Häufigkeit ist seit den sechziger Jahren deutlich angestiegen,
wobei es allerdings keinen schlüssigen Beweis dafür gibt,
dass von diesem Trend jüngere Frauen überproportional betroffen
wären. Auch bei der Sterblichkeit ist Brustkrebs die häufigste
Ursache. Seit kurzem zeigt sich aber auch in Deutschland eine Trendwende,
wie sie in den angelsächsischen Ländern schon seit Begin der
neunziger Jahre zu beobachten ist: Die Sterblichkeit nimmt ab, was durch
eine verbesserte Früherkennung, aber auch durch moderne adjuvante
medikamentöse Therapien erklärt wird.
Das
Mammakarzinom ist in Deutschland mit etwa 50.000 Neuerkrankungsfällen
(1998) nach wie vor der häufigste bösartige Tumor der Frau.
Die Häufigkeit ist seit den sechziger Jahren deutlich angestiegen,
wobei es allerdings keinen schlüssigen Beweis dafür gibt,
dass von diesem Trend jüngere Frauen überproportional betroffen
wären. Auch bei der Sterblichkeit ist Brustkrebs die häufigste
Ursache. Seit kurzem zeigt sich aber auch in Deutschland eine Trendwende,
wie sie in den angelsächsischen Ländern schon seit Begin der
neunziger Jahre zu beobachten ist: Die Sterblichkeit nimmt ab, was durch
eine verbesserte Früherkennung, aber auch durch moderne adjuvante
medikamentöse Therapien erklärt wird.  Einer
der Grundpfeiler bei der Behandlung von Brustkrebs (Mammakarzinom) ist
neben der Operation die Chemotherapie. Dabei werden so genannte Zytostatika
eingesetzt, die als Zellgifte in den Zellzyklus eingreifen und damit
verhindern, dass sich die Krebszellen weiter teilen. Mit der Chemotherapie
sollen eventuell im Körper verbliebene Krebszellen abgetötet
und ein erneutes Wachstum des Tumors (Rezidiv) oder Tochtergeschwülste
(Metastasen) verhindert werden. Um möglichst alle Krebs-zellen
zu eliminieren, werden heute häufig verschiedene Zytostatika miteinander
kombiniert. Damit lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen die
Wirksamkeit deutlich steigern. Das geht aber nicht selten auf Kosten
der Verträglichkeit. Es wird deshalb intensiv an der Entwicklung
neuer Wirkstoffe gearbeitet, um eine gezieltere und gleichzeitig verträglichere
Chemotherapie anbieten zu können.
Einer
der Grundpfeiler bei der Behandlung von Brustkrebs (Mammakarzinom) ist
neben der Operation die Chemotherapie. Dabei werden so genannte Zytostatika
eingesetzt, die als Zellgifte in den Zellzyklus eingreifen und damit
verhindern, dass sich die Krebszellen weiter teilen. Mit der Chemotherapie
sollen eventuell im Körper verbliebene Krebszellen abgetötet
und ein erneutes Wachstum des Tumors (Rezidiv) oder Tochtergeschwülste
(Metastasen) verhindert werden. Um möglichst alle Krebs-zellen
zu eliminieren, werden heute häufig verschiedene Zytostatika miteinander
kombiniert. Damit lässt sich nach den bisherigen Erfahrungen die
Wirksamkeit deutlich steigern. Das geht aber nicht selten auf Kosten
der Verträglichkeit. Es wird deshalb intensiv an der Entwicklung
neuer Wirkstoffe gearbeitet, um eine gezieltere und gleichzeitig verträglichere
Chemotherapie anbieten zu können.  Bald zeigte
sich anhand von Studien, dass die Kombination von Docetaxel und Do-xorubicin
eine sehr wirksame Behandlungsform ist und als Standardtherapie in der
Erstbehandlung von Frauen mit fortgeschrittener Brustkrebserkrankung,
wenn also bereits Tochtergeschwülste (Metastasen) vorliegen, eingesetzt
werden kann.
Bald zeigte
sich anhand von Studien, dass die Kombination von Docetaxel und Do-xorubicin
eine sehr wirksame Behandlungsform ist und als Standardtherapie in der
Erstbehandlung von Frauen mit fortgeschrittener Brustkrebserkrankung,
wenn also bereits Tochtergeschwülste (Metastasen) vorliegen, eingesetzt
werden kann.  Die
Medizin unterscheidet rund 200 verschiedene Krebsarten. Trotz dieser
Vielfalt gehen die meisten Krebserkrankungen auf eine gesunde Zelle
zurück, die sich in einem mehrstufigen Prozess in eine Krebszelle
umgewandelt hat. Je nachdem, welche Zellen sich zu Tumorzellen verändern,
entstehen sehr unterschiedliche Krankheiten, die unterschiedlich verlaufen
und unterschiedlich behandelt werden müssen.
Die
Medizin unterscheidet rund 200 verschiedene Krebsarten. Trotz dieser
Vielfalt gehen die meisten Krebserkrankungen auf eine gesunde Zelle
zurück, die sich in einem mehrstufigen Prozess in eine Krebszelle
umgewandelt hat. Je nachdem, welche Zellen sich zu Tumorzellen verändern,
entstehen sehr unterschiedliche Krankheiten, die unterschiedlich verlaufen
und unterschiedlich behandelt werden müssen. 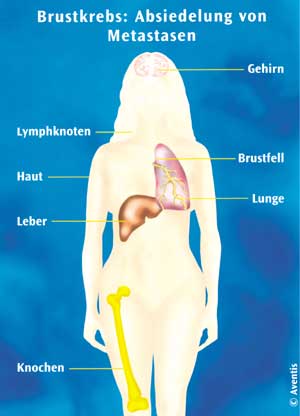 Tochtergeschwulste
des ursprünglichen Tumors in einem anderen Organ. Während
eine gutartige Geschwulst auf ihr Ursprungsgewebe beschränkt bleibt
und sich deshalb relativ leicht entfernen lässt, durchbrechen bösartige
Tumoren die Grenzen zu benachbarten Geweben und verbreiten sich dann
über die Blut- oder Lymphbahnen im Körper. Das Vorhandensein
oder Fehlen von Metastasen ist ein entscheidender Faktor für die
Heilungs- bzw. Überlebenschancen eines Krebspatienten. Schon vor
der Diagnose sind oft Krebszellen des Primärtumors als Metastasen
abgewandert. Oft ruhen sie zeitweise oder gar für immer unentdeckt
in anderen Organen – werden aber sehr gefährlich, wenn sie sich
zu teilen beginnen. Metastasen können manchmal operativ entfernt
werden, etwa in Lunge und Leber. In anderen Organen, etwa im Gehirn
oder in den Knochen, müssen sie durch Bestrahlung bekämpft
werden. Haben sich Metastasen schon an vielen Stellen des Körpers
gebildet, dann bleibt nur die Behandlung mit den Medikamenten, die auch
gegen den Primärtumor wirken. Darmkrebsmetastasen werden dann mit
Darmkrebsmedikamenten behandelt, unabhängig davon, wo sie sich
im Körper angesiedelt haben. Metastasierte Krebserkrankungen sind
oft nicht mehr vollständig zu heilen. Die Behandlung ist dann darauf
ausgerichtet, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die
Symptome zu lindern.
Tochtergeschwulste
des ursprünglichen Tumors in einem anderen Organ. Während
eine gutartige Geschwulst auf ihr Ursprungsgewebe beschränkt bleibt
und sich deshalb relativ leicht entfernen lässt, durchbrechen bösartige
Tumoren die Grenzen zu benachbarten Geweben und verbreiten sich dann
über die Blut- oder Lymphbahnen im Körper. Das Vorhandensein
oder Fehlen von Metastasen ist ein entscheidender Faktor für die
Heilungs- bzw. Überlebenschancen eines Krebspatienten. Schon vor
der Diagnose sind oft Krebszellen des Primärtumors als Metastasen
abgewandert. Oft ruhen sie zeitweise oder gar für immer unentdeckt
in anderen Organen – werden aber sehr gefährlich, wenn sie sich
zu teilen beginnen. Metastasen können manchmal operativ entfernt
werden, etwa in Lunge und Leber. In anderen Organen, etwa im Gehirn
oder in den Knochen, müssen sie durch Bestrahlung bekämpft
werden. Haben sich Metastasen schon an vielen Stellen des Körpers
gebildet, dann bleibt nur die Behandlung mit den Medikamenten, die auch
gegen den Primärtumor wirken. Darmkrebsmetastasen werden dann mit
Darmkrebsmedikamenten behandelt, unabhängig davon, wo sie sich
im Körper angesiedelt haben. Metastasierte Krebserkrankungen sind
oft nicht mehr vollständig zu heilen. Die Behandlung ist dann darauf
ausgerichtet, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und die
Symptome zu lindern.  Sammelbegriff
für eine örtlich umschriebene Zunahme des Gewebevolumens,
der auch für gutartige Schwellungen wie Ödeme und Entzündungen
gilt. Speziell wird der Begriff für Krebsgeschwulste verwendet,
also für ein ungezügeltes und unumkehrbares Überschusswachstum
von körpereigenem Gewebe, bei dem dieses meist seine spezifische
Funktion einbüßt.
Sammelbegriff
für eine örtlich umschriebene Zunahme des Gewebevolumens,
der auch für gutartige Schwellungen wie Ödeme und Entzündungen
gilt. Speziell wird der Begriff für Krebsgeschwulste verwendet,
also für ein ungezügeltes und unumkehrbares Überschusswachstum
von körpereigenem Gewebe, bei dem dieses meist seine spezifische
Funktion einbüßt.