Muskulär oder neuropathisch - Diagnostik von Rückenschmerzen im praktischen Alltag |
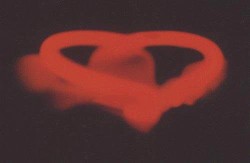 |
|
Neue Evidenz für eine effiziente und rationale Rückenschmerztherapie...
Der lumbale Rückenschmerz (low back pain) oder Kreuzschmerz ist definiert als Schmerzen oder Beschwerden unterhalb des Rippenbogens und oberhalb der Gesäßfalte, mit oder ohne Beinschmerzen. Kreuzschmerzen werden in der Literatur bisher eingeteilt in spezifische und unspezifische Rückenschmerzen, weiterhin je nach Dauer in akute (<12 Wochen), subakute (12 – 24 Wochen), chronische (> 6 Monate) und rezidivierende Rückenschmerzen. Die Einteilung in sogenannte unspezifische Rückenschmerzen beruht auf der Negation, dass es möglich ist, die Ursache dieser Rückenschmerzen zu erfassen und zu klassifizieren. Letztendlich führt diese Weigerung, Patienten mit Kreuzschmerzen exakt zu untersuchen, gezielt zu diagnostizieren und entsprechend kausal zu behandeln, nicht selten in die Chronifizierung. Mindestens 80% aller Deutschen haben mindestens einmal im Leben starke Rückenschmerzen, 35% davon werden chronisch (Schmidt et al., 2007, Schmidt and Kohlmann, 2005). Dr. med. Cordelia Schott
Ursachen von Rückenschmerzen Die gängigen Schmerzmodelle unterscheiden im afferenten Bereich nozizeptive und neuropathische Ursachen von Schmerzen. Häufig treten Kombinationen auf. Der akute Rückenschmerz ist bei suffizienter Therapie der Ursache ein temporärer Schmerz. H Durch myofasziale Triggerpunkte ausgelösten Schmerzen haben eine Punktprävalenz von 30%. Mehr als 7% der Frauen im Alter von 70-80 Jahre leiden am sog. Fibromyalgiesyndrom. Muskuläre Schmerzen sind der häufigste Grund für einen Arztbesuch. Allgemein sollte bei Beschwerden im Bewegungsapparat, wie zum Beispiel Rückenschmerzen, häufiger an muskuläre Ursachen gedacht werden (Mense S. Deutsches Ärzteblatt, Jg. 105, Heft 12, 2008). Funktionelle segmentale Störungen sind ebenfalls ein großer Faktor für Rückenschmerzen und sind immer in Verbindung mit dem Zustand der zugehörigen Muskulatur zu werten und zu therapieren. Auch entzündlichen Veränderungen der Facettengelenke, meistens in Verbindung mit Verschleiß (Facettenarthrose), können konsekutiv zum Hartspann der umgebenden Muskulatur führen, so wie nahezu alle Störungen im Bewegungssegment komplex zu betrachten sind, je nach Ausprägung und Dauer. E Diagnostik Ziel der Diagnostik ist es, die Ursache des Schmerzes bzw. der Störung zu erfassen, um sie schnell und suffizient kausal therapieren zu können. Zusätzlich ist es sinnvoll, durch ein alltagstaugliches, effektives und kostengünstiges Screening Risikopatienten frühzeitig zu erkennen. Weiterführende – auch bildgebende Diagnostik wie Röntgen, CT und MRT – sind aber bei den Patienten indiziert, bei denen die körperliche (neurologische, orthopädische und funktionelle) Diagnostik Hinweise auf strukturelle Störungen wie Bandscheibenvorfälle oder Tumore ergibt und gehören in die Hand des orthopädisch/unfallchirurgischen Facharztes. Da diese genannten Ursachen selten die Ursache von Rückenschmerzen erklären und selbst radiologisch gesicherte Bandscheibenvorfälle in den meisten Fällen nicht die kausale Ursache der aufgetretenen Kreuzschmerzen darstellen (Bolten, 1998), können Bild gebende Verfahren kein universelles Screeningverfahren darstellen. Die viel häufigeren funktionellen Störungen der Körper aufrichtenden Muskulatur entziehen sich diesen Verfahren völlig. Die manualtherapeutische Untersuchung kann die häufigen funktionellen Störungen identifizieren, Funktionsstörungen gezielt palpieren und von anderen Erkrankungen abgrenzen. Diese Untersuchungen sind schneller und kostengünstiger als jede Apparatediagnostik, die erst in zweiter Linie ergänzende Informationen gibt. Für die Identifikation neuropathischer Beschwerden eignen sich in der täglichen Praxis zusätzlich spezielle Fragebögen. Sie erleichtern die Abschätzung neuropathischer Schmerzkomponenten und die Einleitung spezifischerer Abklärung. Der Heidelberger Kurzfragebogen Rücken 10 (HKF R-10©), der auf Initiative der IGOST erarbeitet wurde, erlaubt bereits beim Erstkontakt schnell und suffizient ein Screening auf psychische Komorbiditäten und lässt die wichtige Einschätzung des Chronifizierungsrisikos zu. Durch Einbezug solcher Hilfsmittel besteht die Möglichkeit, den Patienten zeitnah und zielgerichtet einer weiteren Diagnostik und Therapie zuzuführen, um chronifizierende Schmerzverläufe zu verhindern. Medikamentöse Therapie Ziel einer suffizienten Schmerztherapie ist, den Schmerz soweit zu reduzieren, dass Chronifizierungsvorgänge unterbunden werden und eine Mobilisierung des Patienten erreicht wird. Bisherige Leitlinien definierten den Einsatz von Medikamenten an der Zeitdauer der vorliegenden Kreuzschmerzen. Unabhängig der Ursache und zugrunde liegenden Erkrankung wurde der Einsatz von Medikamenten nicht nach pharmakologischen Aspekten angegeben. Dies widerspricht wissenschaftlichen Erkenntnissen, nach denen Medikamente entsprechend Ihres Wirkansatzes einzusetzen sind. Im Vordergrund der Therapie der Patienten mit muskulären Schmerzen steht die Wiederherstellung der Bewegungs- und Übungsfähigkeit durch ausreichende Schmerzlinderung und Spannungsreduktion. Therapeutisch haben sich für funktionelle Veränderungen der Muskulatur und daraus resultierende Schmerzchronifizierung Substanzen bewährt, die sowohl Muskel entspannend als auch analgetisch wirken, mit dem Ziel, die Schmerzchronifizierung nachhaltig verhindern zu wollen, sogenannte Muskelrelaxanzien. Verbreitet eingesetzt werden hier immer noch Benzodiazepine wie beispielsweise Tetrazepam, das meist mit Nebenwirkungen einhergeht wie Müdigkeit, Schwindel, Mundtrockenheit, oft ohne ausreichend stark myotonolytisch zu wirken. Gefürchtet ist das hohe Abhängigkeitspotential dieser Substanzgruppe. Modernere Substanzen wie Flupirtin, ein Nicht-Opioid-Analgetikum, das in retardierter Form nur noch einmal täglich eingenommen werden muss, Pridinolmesilat oder Tolperison haben sich hier zunehmend bewährt und lösen Benzodiazepine in der Anwendung ab. Flupirtin beispielsweise ist analgetisch wirksam mit zusätzlich muskelrelaxierender Wirkung ohne Abhängigkeitspotential und ohne die NSARbedingten typischen gastrointestinalen und kardialen Nebenwirkungen aufzurufen. Der Wirkstoff kann deshalb auch bei Patienten mit gastrointestinalen und kardiovaskulären Begleiterkrankungen sowie älteren Patienten mit längerer Therapiedauer eingesetzt werden. Bei neuropathischen Schmerzen kommen zum einen trizyklische Antidepressiva mit kombiniertem noradrenerg-serotonergem Wirkmechanismus zum Einsatz, z. B. Amitryptilin. Antikonvulsiva wie Gabapentin oder Pregabalin wirken auf spannungsgesteuerte Ca-Kanäle, Gabapentin wirkt darüber hinaus vermutlich über eine Hemmung der glutamatergen Erregungsübertragung. Immer muss neben der Diagnose im Vordergrund eine suffiziente Schmerztherapie stehen, so dass der Patient zeitnah zurück in die Bewegung gebracht werden kann. Hier verlangen leichte Schmerzen leichte Schmerzmittel, starke Schmerzen verlangen starke Schmerzmittel. Auch der frühzeitige Einsatz von Opioiden kann durchaus sinnvoll die Therapie unterstützen, sofern es in einem suffizienten Therapiekonzept angewendet wird. Hier bewährt es sich, das WHO-Stufenschema nicht herauf, sondern im Therapieverlauf herunterzugehen, wenn die Rekonvaleszenz voranschreitet. Bei erhöhtem Chronifizierungsrisiko muss die Behandlung der Patienten zeitnah multimodal erfolgen, abhängig von der Diagnose gehört ggf. zusätzlich zur gezielt eingesetzten medikamentösen Therapie u.a. eine kompetente Physiotherapie, Bewegungstherapie, physikalische Therapie und ggf. Psychotherapie, sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit entsprechend ausgebildeter ärztlicher und nicht-ärztlicher Fachgruppen. |
||
Für Sie entdeckt und zusammengestellt durch ©EPS-Schäffler / D.I.H.T-Verlag G. PlumpTextzusammenstellung: © Ermasch
- Presse - Service, Schäffler / D.I.H.T-Verlag G. Plump |
||
 Die dadurch entstehenden Folgekosten für unser Gesundheitswesen sind enorm, 6% aller Krankheitskosten und 15% aller Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland beruhen auf Rückenschmerzen, jährlich entstehen allein bei dieser Erkrankung bis zu 17 Milliarden Euro Kosten (Bolten et al., 1998). Neuere Studien bestätigen, dass die entscheidenden Risikofaktoren für die Entstehung von Rückenschmerzen nicht ungünstige Körperhaltungen und schwere Arbeit, sondern vielmehr vorangegangene Rückenleiden und psychosoziale Aspekte für eine Chronifizierung prädestinieren. Unbedingt notwendig ist es, den Kreuzschmerz als das zu akzeptieren, was er medizinisch gesehen ist: das Symptom einer Störung verschiedener Strukturen, die diagnostiziert werden muss. Erst danach kann gezielt behandelt werden.
Die dadurch entstehenden Folgekosten für unser Gesundheitswesen sind enorm, 6% aller Krankheitskosten und 15% aller Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland beruhen auf Rückenschmerzen, jährlich entstehen allein bei dieser Erkrankung bis zu 17 Milliarden Euro Kosten (Bolten et al., 1998). Neuere Studien bestätigen, dass die entscheidenden Risikofaktoren für die Entstehung von Rückenschmerzen nicht ungünstige Körperhaltungen und schwere Arbeit, sondern vielmehr vorangegangene Rückenleiden und psychosoziale Aspekte für eine Chronifizierung prädestinieren. Unbedingt notwendig ist es, den Kreuzschmerz als das zu akzeptieren, was er medizinisch gesehen ist: das Symptom einer Störung verschiedener Strukturen, die diagnostiziert werden muss. Erst danach kann gezielt behandelt werden. äufig werden Schmerzen durch muskuläre Veränderungen ausgelöst, wie Überlastung, Verspannungen, Verkürzungen, Dehnungen. Dann handelt es sich um einen nozizeptiven Schmerz. Als Folge der muskulären Veränderungen werden Nozizeptoren in der Muskulatur erregt und Schmerzreize zum zentralen Nervensystem geleitet. Dauernde Fehlbelastungen und Fehlhaltungen, meistens in Kombination mit insuffizienter, untrainierter Muskulatur können u.a. zu rezidivierenden Schmerzereignissen und/oder Dauerschmerz führen. Funktionelle Muskelschmerzen stellen ein großes medizinisches Problem dar, zumal die Diagnostik in hohem Maße abhängig ist von der Ausbildung, Erfahrung und den manuellen Fähigkeiten des Untersuchenden. Muskulär bedingte Schmerzen sind vorwiegend oder ausschließlich klinisch erfassbar und verschließen sich in der Regel der Bildgebung und klassischen Laborwerten. Die Mehrzahl der europäischen Bevölkerung (60-85%) hat irgendwann einmal muskulär bedingte Rückenschmerzen (Lebenszeitprävalenz).
äufig werden Schmerzen durch muskuläre Veränderungen ausgelöst, wie Überlastung, Verspannungen, Verkürzungen, Dehnungen. Dann handelt es sich um einen nozizeptiven Schmerz. Als Folge der muskulären Veränderungen werden Nozizeptoren in der Muskulatur erregt und Schmerzreize zum zentralen Nervensystem geleitet. Dauernde Fehlbelastungen und Fehlhaltungen, meistens in Kombination mit insuffizienter, untrainierter Muskulatur können u.a. zu rezidivierenden Schmerzereignissen und/oder Dauerschmerz führen. Funktionelle Muskelschmerzen stellen ein großes medizinisches Problem dar, zumal die Diagnostik in hohem Maße abhängig ist von der Ausbildung, Erfahrung und den manuellen Fähigkeiten des Untersuchenden. Muskulär bedingte Schmerzen sind vorwiegend oder ausschließlich klinisch erfassbar und verschließen sich in der Regel der Bildgebung und klassischen Laborwerten. Die Mehrzahl der europäischen Bevölkerung (60-85%) hat irgendwann einmal muskulär bedingte Rückenschmerzen (Lebenszeitprävalenz). rst direkte Störungen am Nerv, z. B. durch Druck beim Bandscheibenvorfall oder durch Einengungen des Spinalkanals, lösen singulär oder zusätzlich „klassische" neuropathische Beschwerden aus. Nach Expertenmeinung ist aber auch die sympathische Reflexaktivierung als letztendlich neuropathischer Schmerz anzusehen (CRPS I, früher M. Sudeck). Andere Ursachen neuropathischer Schmerzen spielen beim Kreuzschmerz eine vernachlässigbare Rolle. Große epidemiologische Studien zeigen, dass im Gegensatz zu muskulären Schmerzen neuropathische Komponenten nur bei ca. 20-30 % der Rückenschmerzen auftreten (Freynhagen R, Baron R. Curr Pain Headache Rep. 2009 Jun;13(3):185-90). In diesem Zuge muss die aus orthopädischer Sicht unbefriedigende Einteilung in spezifisch und unspezifisch hinterfragt werden: Entsprechend der Definition (Brockhaus) von spezifisch als: arteigen, kennzeichnend, für eine Krankheit, charakteristisch, wurde der Begriff spezifischer Rückenschmerz eingeführt. Rückenschmerz galt als spezifisch wenn er einer pathogenetisch relevanten Einzelursache zuordenbar war, entsprechende organische Läsionen bestanden und eine gezielte Behandlung möglich war. In Deutschland wird der Großteil der Rückenschmerzen, nämlich 90%, heute immer noch als „unspezifisch" benannt, lediglich 10% der Patienten mit Rückenschmerzen leiden nach aktueller Klassifikation an „spezifischem" Rückenschmerz mit anatomisch/neurophysiologisch erfassbarer Kausalität wie Gleitwirbel, Bandscheibenprolaps, Wirbelkörperfraktur, Tumor, Infektion etc. (Schmidt et al., 2007; Göbel, 2001). Diese Einteilung muss kritisch hinterfragt werden, es drängt sich die Frage auf, ob tatsächlich 90% der Kreuzschmerzen nicht diagnostizierbar sind oder letztendlich einfach nicht ausreichend diagnostiziert werden. Hierzu hat die IGOST eine medikamentöse Leitlinie Rückenschmerz erarbeitet (Strohmeier 2010). Psychische Komorbiditäten, vor allem Ängste, frühere Erlebnisse oder Lebenskrisen beeinflussen die absteigenden, hemmenden Bahnen und begünstigen die Schmerzchronifizierung ebenfalls, so dass anzunehmen ist, dass jedes erneute Auftreten von Rückenschmerzen eine spätere Chronifizierung begünstigt.
rst direkte Störungen am Nerv, z. B. durch Druck beim Bandscheibenvorfall oder durch Einengungen des Spinalkanals, lösen singulär oder zusätzlich „klassische" neuropathische Beschwerden aus. Nach Expertenmeinung ist aber auch die sympathische Reflexaktivierung als letztendlich neuropathischer Schmerz anzusehen (CRPS I, früher M. Sudeck). Andere Ursachen neuropathischer Schmerzen spielen beim Kreuzschmerz eine vernachlässigbare Rolle. Große epidemiologische Studien zeigen, dass im Gegensatz zu muskulären Schmerzen neuropathische Komponenten nur bei ca. 20-30 % der Rückenschmerzen auftreten (Freynhagen R, Baron R. Curr Pain Headache Rep. 2009 Jun;13(3):185-90). In diesem Zuge muss die aus orthopädischer Sicht unbefriedigende Einteilung in spezifisch und unspezifisch hinterfragt werden: Entsprechend der Definition (Brockhaus) von spezifisch als: arteigen, kennzeichnend, für eine Krankheit, charakteristisch, wurde der Begriff spezifischer Rückenschmerz eingeführt. Rückenschmerz galt als spezifisch wenn er einer pathogenetisch relevanten Einzelursache zuordenbar war, entsprechende organische Läsionen bestanden und eine gezielte Behandlung möglich war. In Deutschland wird der Großteil der Rückenschmerzen, nämlich 90%, heute immer noch als „unspezifisch" benannt, lediglich 10% der Patienten mit Rückenschmerzen leiden nach aktueller Klassifikation an „spezifischem" Rückenschmerz mit anatomisch/neurophysiologisch erfassbarer Kausalität wie Gleitwirbel, Bandscheibenprolaps, Wirbelkörperfraktur, Tumor, Infektion etc. (Schmidt et al., 2007; Göbel, 2001). Diese Einteilung muss kritisch hinterfragt werden, es drängt sich die Frage auf, ob tatsächlich 90% der Kreuzschmerzen nicht diagnostizierbar sind oder letztendlich einfach nicht ausreichend diagnostiziert werden. Hierzu hat die IGOST eine medikamentöse Leitlinie Rückenschmerz erarbeitet (Strohmeier 2010). Psychische Komorbiditäten, vor allem Ängste, frühere Erlebnisse oder Lebenskrisen beeinflussen die absteigenden, hemmenden Bahnen und begünstigen die Schmerzchronifizierung ebenfalls, so dass anzunehmen ist, dass jedes erneute Auftreten von Rückenschmerzen eine spätere Chronifizierung begünstigt.