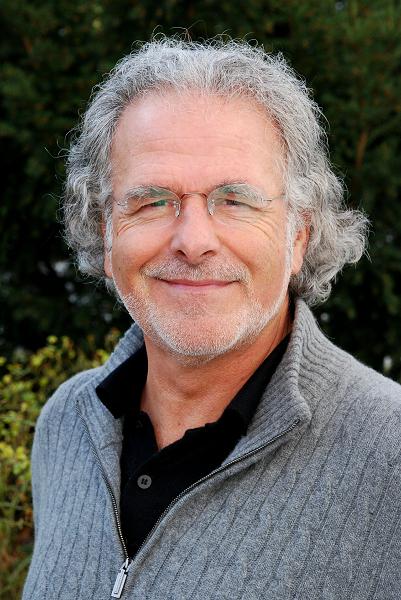 Multimodalität der Schmerztherapie - neurobiologische Grundlagen
Prof. Dr. med. Walter Zieglgänsberger (links im Bild)
In Deutschland werden Millionen Menschen zu chronischen Schmerzpatienten,
obwohl das bei einem großen Teil der Betroffenen durch gezielte Prävention und
frühe konsequente Behandlung verhindert werden könnte. Chronischer Schmerz
ist kein Symptom einer Krankheit, sondern eine komplexe Erkrankung. Die biopsychosozialen Komponenten erfordern interdisziplinäre Disease-Management-
Programme in Versorgungsstrukturen, die den psychischen und körperlichen
Wünschen des einzelnen Patienten entgegenkommen.
Multimodalität der Schmerztherapie - neurobiologische Grundlagen
Prof. Dr. med. Walter Zieglgänsberger (links im Bild)
In Deutschland werden Millionen Menschen zu chronischen Schmerzpatienten,
obwohl das bei einem großen Teil der Betroffenen durch gezielte Prävention und
frühe konsequente Behandlung verhindert werden könnte. Chronischer Schmerz
ist kein Symptom einer Krankheit, sondern eine komplexe Erkrankung. Die biopsychosozialen Komponenten erfordern interdisziplinäre Disease-Management-
Programme in Versorgungsstrukturen, die den psychischen und körperlichen
Wünschen des einzelnen Patienten entgegenkommen.
Der Paradigmenwechsel in der Schmerztherapie betrifft sowohl die Behandlung
akuter wie auch chronischer Schmerzzustände. Wird Schmerz zum ständigen
Begleiter, geht seine wichtige Warnfunktion verloren und es beginnt ein
verhängnisvoller Kreislauf. Da intensive Schadreize nachweislich zur
Sensibilisierung zentraler Nervenzellen führen können, bietet sich die
Möglichkeit, Behandlungen nicht nur auf die Stelle der peripheren
Gewebeschädigung zu richten, sondern auch auf Veränderungen in Strukturen
des Zentralnervensystems. Schmerzreize führen über die Aktivierung limbischer
Strukturen wie der Amygdala, dem Hippocampus, großen Anteilen des
Frontalcortex und des cingulären Cortex zu einer Angstkonditionierung. Angst vor
einem wiederkehrenden akuten Schmerzerleben führt zu Symptomen einer
Stresserkrankung. Die angstbesetzte Erinnerung an den Schmerz bleibt auch
dann bestehen, wenn keine .JPG) nozizeptiven Signale mehr auf das Nervensystem
einwirken. Bei vielen Patienten wird die Angst vor den wiederkehrenden oder den
weiter bestehenden Schmerzen übermächtig. Sie beginnen, ihren
Lebensrhythmus zunehmend am Verlauf der Schmerzattacken zu orientieren.
nozizeptiven Signale mehr auf das Nervensystem
einwirken. Bei vielen Patienten wird die Angst vor den wiederkehrenden oder den
weiter bestehenden Schmerzen übermächtig. Sie beginnen, ihren
Lebensrhythmus zunehmend am Verlauf der Schmerzattacken zu orientieren.
Die Patienten ziehen sich mehr und mehr zurück. Der soziale Rückzug fördert
wiederum Schmerzen und Depression. Ihre zunehmende Angst verhindert, dass
sie Dinge tun, die ihnen früher Freude bereitet haben. Eine moderne
Schmerztherapie muss daher die Angst vor der nächsten Schmerzattacke
mitberücksichtigen. Die Situation chronischer Schmerzpatienten gleicht der von
Folteropfern. Auch Folter basiert auf der bloßen Androhung eines zuvor bereits
zugefügten Schmerzes und der Angst davor. Ein nur kurz wirksames
Analgetikum verstärkt diese psychische Komponente unter Umständen noch, da
der Patient ständig daran denken muss, das Medikament zeitgenau
einzunehmen.
Die Lernfähigkeit und enorme Plastizität des menschlichen Gehirns macht es
möglich, neue Erfahrungen im Gehirn zu verankern, wodurch alte Erinnerungen
allmählich verblassen, wenn sie nicht  ständig wieder aufgefrischt werden ("Re-
Learning"). Nach heutigen Erkenntnissen kann eine Modifikation einer
dysfunktionalen Kognition nur durch einen multimodalen Therapieansatz zu
Lebensqualität durch effiziente Therapie von Rückenschmerzen
und Osteoporose nachhaltigen Erfolgen führen. Bei diesen Therapiealgorithmen werden
Medikamente mit teils sehr unterschiedlichen Wirkmechanismen gemeinsam mit
verschiedenen Formen der Verhaltenstherapie kombiniert.
ständig wieder aufgefrischt werden ("Re-
Learning"). Nach heutigen Erkenntnissen kann eine Modifikation einer
dysfunktionalen Kognition nur durch einen multimodalen Therapieansatz zu
Lebensqualität durch effiziente Therapie von Rückenschmerzen
und Osteoporose nachhaltigen Erfolgen führen. Bei diesen Therapiealgorithmen werden
Medikamente mit teils sehr unterschiedlichen Wirkmechanismen gemeinsam mit
verschiedenen Formen der Verhaltenstherapie kombiniert.
Um die Angst vor dem
Schmerz anzugehen, werden bei der Behandlung chronischer Schmerzen auch
Substanzen ohne direkte analgetische Wirkung eingesetzt. Ziel dieses
Therapieansatzes ist es, Lernprozesse im Gehirn anzustoßen, um alte und
unangenehme Gedächtnisinhalte quasi zu "überschreiben". Wichtig ist dabei, die
Schmerzlinderung möglichst in der gewohnten Umgebung des Patienten zu
erreichen. Eine adäquate Retardgalenik macht es möglich, den Wirkstoffspiegel
im Blut über den Tag nahezu konstant zu halten und so die Alltagsaktivität des so
auch meist ausreichend vigilanten Patienten zu erreichen.
 Präparate, die über 24 Stunden wirkungsvoll den Schmerz bekämpfen, lassen
den Patienten "vergessen", dass er behandelt wird und er wird so auch nicht
ständig schmerzlich an sein Leiden erinnert. Wenn der erwartete Schmerz nicht
auftritt, ist der Weg frei für neue, positive Assoziationen, die dann auch in einer
Rehabilitation gefördert werden können. So kann beispielsweise retardiertes
Flupirtin eingesetzt werden, um zusammen mit verhaltenstherapeutischen
Maßnahmen, die das "Re-Learning" fördern, das Schmerzgedächtnis zu
überschreiben. Auf Grund eines spezifischen Wirkmechanismus wird das
Ruhemembranpotenzial von Nervenzellen anhaltend stabilisiert und damit deren
Erregbarkeit gehemmt.
Präparate, die über 24 Stunden wirkungsvoll den Schmerz bekämpfen, lassen
den Patienten "vergessen", dass er behandelt wird und er wird so auch nicht
ständig schmerzlich an sein Leiden erinnert. Wenn der erwartete Schmerz nicht
auftritt, ist der Weg frei für neue, positive Assoziationen, die dann auch in einer
Rehabilitation gefördert werden können. So kann beispielsweise retardiertes
Flupirtin eingesetzt werden, um zusammen mit verhaltenstherapeutischen
Maßnahmen, die das "Re-Learning" fördern, das Schmerzgedächtnis zu
überschreiben. Auf Grund eines spezifischen Wirkmechanismus wird das
Ruhemembranpotenzial von Nervenzellen anhaltend stabilisiert und damit deren
Erregbarkeit gehemmt.
Dieser sogenannte SNEPCO-Mechanismus kann so
auch Schmerzen, die bereits über längere Zeit bestehen, günstig beeinflussen,
da biochemische Prozesse angesteuert .JPG) werden, die die Grundlage von
neuronaler Übererregbarkeit und zellulärem Schmerzgedächtnis bilden. Auch
nach einer bereits eingetretenen Chronifizierung lassen sich durch konsequente
langfristige Reduktion des neuronalen Einstroms und Dämpfung zentraler
neuronaler Überaktivität noch therapeutische Erfolge erzielen. Es ist davon
auszugehen, dass eine aktivitätsabhängige Genexpression, die zu einer
Steigerung der neuronalen Erregbarkeit geführt hat, bei einer Verminderung z. B.
des synaptischen Zustroms oder der spontanen Entladungstätigkeit auch wieder
abnehmen kann.
werden, die die Grundlage von
neuronaler Übererregbarkeit und zellulärem Schmerzgedächtnis bilden. Auch
nach einer bereits eingetretenen Chronifizierung lassen sich durch konsequente
langfristige Reduktion des neuronalen Einstroms und Dämpfung zentraler
neuronaler Überaktivität noch therapeutische Erfolge erzielen. Es ist davon
auszugehen, dass eine aktivitätsabhängige Genexpression, die zu einer
Steigerung der neuronalen Erregbarkeit geführt hat, bei einer Verminderung z. B.
des synaptischen Zustroms oder der spontanen Entladungstätigkeit auch wieder
abnehmen kann.
Durch eine medikamentöse Therapie, die den Schmerz
kontinuierlich unter Kontrolle hält, kann man chronischen Schmerzpatienten die
Angst vor der nächsten Attacke nehmen; sie entwickeln Vertrauen in
schmerztherapeutische Maßnahmen und erkennen, dass sie diesen Prozess
auch durch eigenes Verhalten steuern können. Mit modernen Retardtabletten
lässt sich so der Teufelskreis der Schmerzchronifizierung durch "Re-Learning"
leichter durchbrechen.


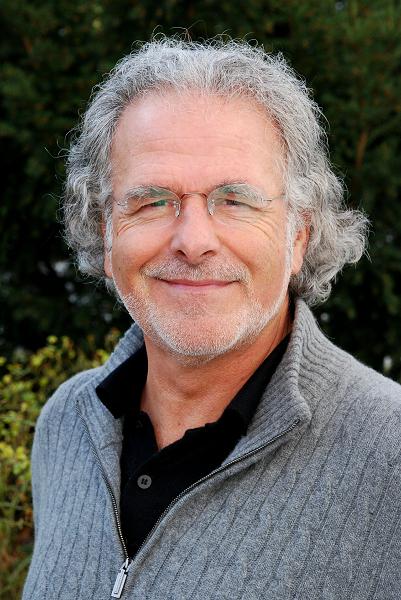 Multimodalität der Schmerztherapie - neurobiologische Grundlagen
Prof. Dr. med. Walter Zieglgänsberger (links im Bild)
In Deutschland werden Millionen Menschen zu chronischen Schmerzpatienten,
obwohl das bei einem großen Teil der Betroffenen durch gezielte Prävention und
frühe konsequente Behandlung verhindert werden könnte. Chronischer Schmerz
ist kein Symptom einer Krankheit, sondern eine komplexe Erkrankung. Die biopsychosozialen Komponenten erfordern interdisziplinäre Disease-Management-
Programme in Versorgungsstrukturen, die den psychischen und körperlichen
Wünschen des einzelnen Patienten entgegenkommen.
Multimodalität der Schmerztherapie - neurobiologische Grundlagen
Prof. Dr. med. Walter Zieglgänsberger (links im Bild)
In Deutschland werden Millionen Menschen zu chronischen Schmerzpatienten,
obwohl das bei einem großen Teil der Betroffenen durch gezielte Prävention und
frühe konsequente Behandlung verhindert werden könnte. Chronischer Schmerz
ist kein Symptom einer Krankheit, sondern eine komplexe Erkrankung. Die biopsychosozialen Komponenten erfordern interdisziplinäre Disease-Management-
Programme in Versorgungsstrukturen, die den psychischen und körperlichen
Wünschen des einzelnen Patienten entgegenkommen. ständig wieder aufgefrischt werden ("Re-
Learning"). Nach heutigen Erkenntnissen kann eine Modifikation einer
dysfunktionalen Kognition nur durch einen multimodalen Therapieansatz zu
Lebensqualität durch effiziente Therapie von Rückenschmerzen
und Osteoporose nachhaltigen Erfolgen führen. Bei diesen Therapiealgorithmen werden
Medikamente mit teils sehr unterschiedlichen Wirkmechanismen gemeinsam mit
verschiedenen Formen der Verhaltenstherapie kombiniert.
ständig wieder aufgefrischt werden ("Re-
Learning"). Nach heutigen Erkenntnissen kann eine Modifikation einer
dysfunktionalen Kognition nur durch einen multimodalen Therapieansatz zu
Lebensqualität durch effiziente Therapie von Rückenschmerzen
und Osteoporose nachhaltigen Erfolgen führen. Bei diesen Therapiealgorithmen werden
Medikamente mit teils sehr unterschiedlichen Wirkmechanismen gemeinsam mit
verschiedenen Formen der Verhaltenstherapie kombiniert.  Präparate, die über 24 Stunden wirkungsvoll den Schmerz bekämpfen, lassen
den Patienten "vergessen", dass er behandelt wird und er wird so auch nicht
ständig schmerzlich an sein Leiden erinnert. Wenn der erwartete Schmerz nicht
auftritt, ist der Weg frei für neue, positive Assoziationen, die dann auch in einer
Rehabilitation gefördert werden können. So kann beispielsweise retardiertes
Flupirtin eingesetzt werden, um zusammen mit verhaltenstherapeutischen
Maßnahmen, die das "Re-Learning" fördern, das Schmerzgedächtnis zu
überschreiben. Auf Grund eines spezifischen Wirkmechanismus wird das
Ruhemembranpotenzial von Nervenzellen anhaltend stabilisiert und damit deren
Erregbarkeit gehemmt.
Präparate, die über 24 Stunden wirkungsvoll den Schmerz bekämpfen, lassen
den Patienten "vergessen", dass er behandelt wird und er wird so auch nicht
ständig schmerzlich an sein Leiden erinnert. Wenn der erwartete Schmerz nicht
auftritt, ist der Weg frei für neue, positive Assoziationen, die dann auch in einer
Rehabilitation gefördert werden können. So kann beispielsweise retardiertes
Flupirtin eingesetzt werden, um zusammen mit verhaltenstherapeutischen
Maßnahmen, die das "Re-Learning" fördern, das Schmerzgedächtnis zu
überschreiben. Auf Grund eines spezifischen Wirkmechanismus wird das
Ruhemembranpotenzial von Nervenzellen anhaltend stabilisiert und damit deren
Erregbarkeit gehemmt.